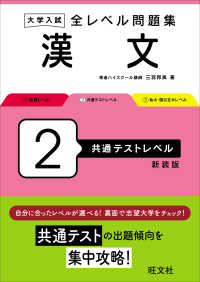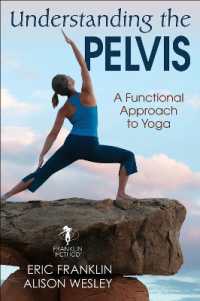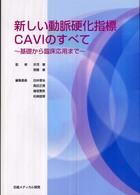- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > History
Description
(Text)
Die vorliegende Arbeit hat eine Fallstudie aus dem Bereich des österreichischen Staatskirchenrechts zum Thema: die Entstehung des Konkordats zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl vom 5. Juni 1933. Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Forschungsfrage, ob das Konkordat als Hervorbringung der semifaschistisch-autoritären Diktatur des Ständestaates bezeichnet werden kann. Da das Konkordat gleichzeitig mit der Verfassung vom 1. Mai 1934 kundgemacht wurde, ist das ein häufig zu hörender Vorwurf.
Daher werden die historischen Voraussetzungen unter Einbeziehung des Konkordats vom 18. August 1855 entlang ihrer Zeitlinie analysiert und der Versuch unternommen, diesen schwerwiegenden Vorwurf als haltlos zu entlarven. Die Relevanz des Themas für die Allgemeinheit zeigt sich am deutlichsten in dem Umstand, dass das österreichische Konkordat von 1933/34 von seinen Kritikern immer wieder scharf angegriffen und ihm seine Existenzberechtigung abgesprochen wird.
(Extract)
Textprobe:
Kapitel 4.1, Die Ausgangslage:
Die Ausgangssituation der katholischen Kirche in Österreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts war durch die josephinische Gesetzgebung geprägt. Kaiser Joseph II. (1764-1790) ging als aufgeklärter Despot von dem Grundsatz aus, dass die Leitung sämtlicher Kirchen dem Staatoberhaupte zukomme, und verbot deshalb den freien Verkehr der Gläubigen und der Geistlichkeit seines Reiches mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche, wie er auch die Verkündigung sämtlicher kirchlicher Verordnungen, selbst wenn es sich um reine Glaubenssachen handelte, von seiner vorherigen Genehmigung (Placet) abhängig machte. Die Einmischung des Kaisers in die rein kirchlichen Angelegenheiten überstieg jedes Maß und führte zu für die römisch-katholische Kirche unerträglichen Zuständen, die auch während der kurzen Herrschaft seines Nachfolgers Leopold II. (1790-1792) unverändert blieben. Andere Religionsgemeinschaften haben seine Herrschaft bis heute als eine für sie segensreiche in Erinnerung.
Franz II./I. (1792-1806 / 1804-1835) indessen erkannte bereits die Notwendigkeit von Reformen der kirchlichen Verhältnisse in Österreich; unter Ferdinand I. (1835-1848) wurde eine Kommission zur Vorbereitung eines Konkordats eingesetzt, jedoch trat die entscheidende Wendung erst mit dem Regierungsantritt Franz Josephs I. (1848-1916) im Jahre 1848 ein. Dieser erklärte alle josephinischen und leopoldinischen Kirchengesetze für aufgehoben und ließ den Verkehr der Gläubigen und des Klerus mit dem Papste wieder zu. Desgleichen stellte er die Disziplinargewalt der Bischöfe wieder her und leitete mit dem Heiligen Stuhl Verhandlungen über den Abschluß eines Konkordats am 2. Dezember 1852 ein. Diese Verhandlungen mündeten in das am 18. August 1855 in Wien abgeschlossene Konkordat.
Dieses Konkordat wurde am 25. September 1855 vom Kaiser und am 2. November 1855 von Papst Pius IX. (16.6.1846-7.2.1878) ratifiziert und publiziert. Mit Patent vom 5. November 1855 erfolgtedie Publikation des Konkordats als Staatsgesetz. Die römische Kurie hatte damit einen Pyrrhussieg errungen, denn dieser Konkordatsabschluss sollte als ein anachronistisches Missgeschick das Verhältnis von Kirche und Staat in Österreich beinahe ein Jahrhundert lang belasten: Hierokratische Prinzipien hatten sich im Neoabsolutismus Österreichs durchgesetzt, und das Konkordat, als Bündnis zwischen Thron und Altar konzipiert, hatte den Thron dem Altar subordiniert .
Erika Weinzierl verweist auf die zweifache Bedeutung dieses Konkordats: Einerseits war es der Verzicht des Staates auf das seit mehr als drei Vierteljahrhunderten ausgeübte josephinische Kirchenregiment und damit ein feierlicher Friedensschluß zwischen Papst und Kaiser. Andererseits aber war es durch den Zeitpunkt seines Abschlusses auf der Höhe des neoabsolutistischen Regimes und seine großen Zugeständnisse an die Kirche den österreichischen Liberalen von Anfang an ein Stein des Anstoßes. Ihren jahrelangen erbitterten Angriffen ist es schließlich auch zum Opfer gefallen .
4.2, Krise und Lösung des Konkordats von 1855:
Dem Liberalismus jener Zeit war wie Max Hussarek es in seiner akribischen Untersuchung auf den Punkt bringt die formelle Wahrung der staatlichen Souveränität in kirchenpolitischen Dingen die Hauptsache, und er verwarf ohne nähere Prüfung alles, was dieser zuwiderlaufen schien. Dabei stand im Vordergrund das Konkordat, in welchem nicht bloß die Verkörperung des kirchenpolitischen Systems, sondern überhaupt das Symbol der gesamten Richtung des Staatswesens erblickt wurde. Gerade diese und nicht einzelne Sätze der vertragsmäßig mit dem Heiligen Stuhle vereinbarten einschlägigen Rechtsordnung bildeten den Gegenstand des Angriffes .
1867 wurde in Ausführung eines kaiserlichen Entschlusses der bisherige Gesandte in Spanien, Albert Graf von Crivelli, auf den Posten des österreichischen Botschafters beim Heiligen Stuhl berufen. Die dem Grafen Crivel