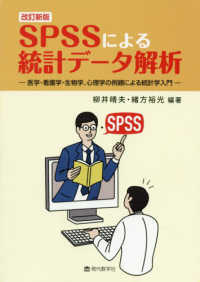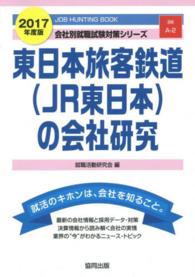Description
(Text)
Der Schriftgebrauch des Autors ist für die Rezeption von entscheidendem Einfluß. Dies gilt insbesondere für den anspruchsvollen japanischen Abenteuerroman des 19. Jahrhunderts, das yomihon . Das Hakkenden ("Historia von den Acht Hunden", von 1814 bis 1842 in Fortsetzungen erschienen) gilt als Klassiker unter den yomihon . Der Autor dieses monumentalen Werkes, Takizawa Bakin (1767-1848), verwendet die Doppelschreibung aus chinesischen Wortzeichen und japanischen Silbenzeichen auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen. Die eine Weise des Schriftgebrauchs ist am zeitgenössischen orthographischen Standard orientiert, die andere weicht absichtsvoll von diesem Standard ab. Die Arbeit versucht, zwei kleine Teile des Hakkenden durch die "Lesebrille" des Eitai setsuyô , eines umfangreichen Wörterbuchs, zu lesen. Unter der Annahme, daß das Eitai setsuyô (1752-1849) den orthographischen Standard zur Zeit der Entstehung des Hakkenden wiedergibt, werden Bakins Abweichungen vom Standard festgestellt und mit Hilfe einfacher semiotischer Terminologie nach ihrer Ausdrucksabsicht klassifiziert.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Gegenstand, Hilfsmittel und Methode der Analyse: Das Hakkenden - Das Eitai Setsuyô - Methode der Analyse - Das quantitative Verhältnis kommunikativer und expressiver Graphie in den ausgewählten Hakkenden -Passagen - Stichproben außerhalb der ausgewählten Textpassagen - Strukturelle Analyse der expressiven Graphie: "Neuchinesisches Kolorit" - Semantische Domino-Steine - Verkleidung und Entkleidung - Der generelle Effekt expressiver Graphie - Kommentierte Übersetzung - Die Expressiven Graphien als "Destillat" aus dem individuellen Lexikon.
(Author portrait)
Der Autor: Guido Woldering studierte von 1982 bis 1987 Japanologie, Sinologie und Germanistik an der Universität Frankfurt am Main. Von 1987 bis 1989 war er Lektor für Deutsche Sprache an der
saka Gaikokugo Daigaku in
saka/Japan, von 1989 bis 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Japanologischen Seminar der Universität Heidelberg, anschließend bis 1996 an der Universität Frankfurt am Main. Seit 1997 ist der Autor Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt «Das Vorwort als rezeptionslenkende Textsorte in der japanischen Literatur von 1848 bis 1890» am Japanologischen Seminar der Universität Heidelberg.