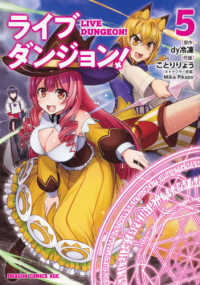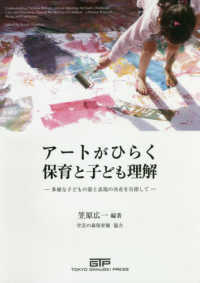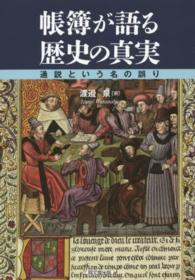- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > History
- > 20th century (1914-1955/49)
Description
(Text)
Wie betrauerten die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg ihre Toten? Und auf welche Weise wurde das Nationale in Monumenten stetig umgedeutet? Die nach 1918 in Berlin, München und Bonn errichteten Denkmale bildeten ein wesentliches Fundament nationalen Selbstverständnisses. Institutionell starke Gruppen konstruierten in ihnen Sinnwelten, die aufs Engste mit der kollektiven Identitätsstiftung verknüpft waren. Zugleich war kein modernes Artefakt so sehr durch Identitätsverlust gekennzeichnet wie das Kriegsmonument der Weimarer Republik. Diese Studie gibt einen tiefen kulturgeschichtlichen Einblick in die am Denkmal manifesten Mikrokosmen der Trauer und des Nationalen und macht deutlich, dass der Kriegstod nicht nur zugunsten des Nationalen aufgehoben, sondern auch entpolitisiert wurde.
(Author portrait)
Stoffels, MichaelaMichaela Stoffels war Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Köln und ist derzeit als Studienleiterin für Kunst in der Katholischen Akademie Schwerte tätig.Stoffels, Michaela Michaela Stoffels war Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Köln und ist derzeit als Studienleiterin für Kunst in der Katholischen Akademie Schwerte tätig.
(Table of content)
ur Demonstration objektiver Trauer
Zur Gestaltung der beiden Universitätsdenkmäler
2.1. "Zum Zerreißen straff". Ikonologie des ersten Kriegerdenkmals
2.2. Trauer, Trost und Aufklärung. Beschreibung der Ehrenhalle
3. Ende des nationalen Zusammenhalts
Zur Rezeption beider Universitätsdenkmäler
3.1. Revolutionäre Wiedergeburt.
Zur Einweihungsfeier von Flamme empor
3.2. Mahnende Stille. Die Einweihungsfeier der Ehrenhalle
TEIL 2 - GRENZVERSCHIEBUNGEN DES TRAGISCHEN HELDEN
DER OFFIZIELLE DENKMALBAU UND -KULT ZWISCHEN
MILITÄRISCHEM UND ZIVILEM TOTENGEDENKEN
I. Zwischen Krieg und Frieden. Das städtisch-bayerische Kriegerdenkmal
auf dem Vorplatz des ehemaligen Münchener Armeemuseums
1. Vom Miteinander divergierender Trauerkonzepte
in der Planungsphase des Denkmals
1.1. Grenzen militärischer Erinnerungsmacht.
Die erste Planungsphase
a) Der Kampf um zivile Aufklärung. Der erste Denkmalwettbewerb
b) Die Gedächtniskapelle im Münchener Rathaus
als moderate Gegeninitiative
1.2. Ausmaß militärischer Erinnerungsmacht
Die zweite Planungsphase
a) Die Durchsetzung nationaler Freigabe. Der engere Wettbewerb
b) Das bayerische Armeedenkmal als
militärisches Identifikationssymbol
1.3. Zum Spielraum objektiver Trauer im Kriegsmonument
Die Neugestaltung des Denkmalplatzes
2. Zwischen männlichem Heroen und weiblicher Trauer
Der komplementäre Geschlechtercode und die Denkmalgestaltung
2.1.Die Krypta und das Gesicht des schlafenden Helden
2.2. Der Denkmalshof und die Gesichtslosigkeit der Opfer
3. Zum nationalen Potential von Riten am bayerischen Totengrab
3.1. Rezeptionsglück? Kriegerdenkmal unter Blumen und Steinen
3.2. Rezeptionsunglück
a) Triumphale Heldensucht. Die Grundsteinlegung
b) Wehrhafte Nation. Denkmalfeiern zwischen 1924 und 1932
II. Zwischen Frieden und Krieg. Die Berliner Neue Wache
als Gedächtnisstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs
1. Vom bloß