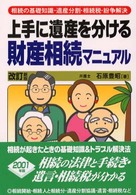- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > History
- > miscellaneous
Description
(Short description)
Die fesselnde Geschichte der komplexen Herstellung und der ausgefeilten Vermarktung des künstlichen Vitamins C zeigt auf, wie diesem durch kulturelle, ökonomische, politische und technische Mechanismen zum Erfolg verholfen wurde. Das künstliche VitaminC avancierte zur eigentlichen Volksdroge.
(Text)
Künstlich hergestelltes Vitamin C ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es findet sich nicht nur in Multivitaminpräparaten, sondern beispielsweise auch zu Konservierungszwecken in zahlreichen Nahrungsmitteln. Der Aufstieg des künstlichen Vitamins C begann 1933. Am Anfang war es nicht mehr als eine Wunderdroge, von der man nicht recht wusste, wozu sie eigentlich gut war. Spätestens zu Beginn des Kalten Krieges wurde Vitamin C als notwendig für die Aufrechterhaltung der Gesundheit in industriellen Gesellschaften angesehen. An dessen erstaunlicher Karriere waren zahlreiche Institutionen und Akteure beteiligt. Ins Zentrum eines Netzwerkes gelangte mehr und mehr das Basler Pharmaunternehmen Hoffmann-La Roche. Ausgehend von Patentrechten des in der Schweiz eingebürgerten «Ostjuden» Tadeus Reichstein eroberte Roche eine marktbeherrschende Position im Vitamin-C-Geschäft. Bei ihrem Aufstieg zur weltweit führenden Vitaminproduzentin machte Roche nicht nur erste Erfahrungen mit derBiotechnologie, sondern traf auch auf Chemiegiganten aus dem «Dritten Reich». Um dem künstlichen Vitamin C zum Durchbruch zu verhelfen, musste es zudem im Verbund mit Gesundheitsbehörden gelingen, neue Krankheitsbilder zu schaffen, welche die Einnahme von Vitamin C als ratsam erscheinen liessen. Dieses Bestreben stand im Kontext der Entstehung eines statistischen Gesundheitsbegriffs und der gesellschaftlichen Suche nach verbesserter Gesundheit. Der Konsum von Vitamin C wurde im Schatten des Zweiten Weltkrieges zu einer neuen Bürgerpflicht. Die Sorge galt dabei nicht mehr nur der individuellen, sondern immer mehr auch der Gesundheit des «Volkswirtschaftskörpers». Das Quellenmaterial aus dem Nachlass des Nobelpreisträgers Tadeus Reichstein und dem Historischen Archiv Roche ermöglicht nicht nur se


![HORS CADRE[S] N 5 CARNETS ET ESQUISSES (HORS CADRE(S))](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)