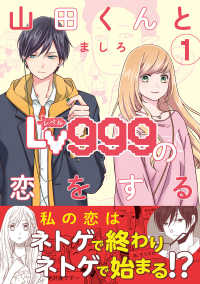Description
(Text)
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die literarischen Funktionen der Tiermetamorphose in den Werken von Clarice Lispector und Brigitte Kronauer genauer zu untersuchen. Dazu wird der kulturelle und historische Kontext der beiden Autorinnen beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt ist der direkte Vergleich mehrerer Werke von Lispector und Kronauer, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Schreibstilen hervorheben sowie die verschiedenen Tiermetamorphosen in Bezug zueinander setzen soll.
Unterstützt wird die Analyse durch die philosophischen Interpretationsansätze der französischen Philosophen Deleuze und Guattari sowie den feministischen Ansatz Donna Haraways.
(Extract)
Textprobe:
Kapitel 3.1, Der Begriff der Entfremdung:
Bevor ich zum eigentlichen Thema der Tierperspektiven anhand der Werke von Clarice Lispector und von Brigitte Kronauer komme, ist es sinnvoll, zu Beginn den Begriff der Entfremdung näher zu beleuchten, um später Rückschlüsse anhand dieses Begriffes ziehen zu können. Der Begriff der Entfremdung kommt aus dem Sachrecht und wurde von Jean-Jacques Rousseau als vollständige bzw. totale Entäußerung definiert, die die Freiheitsrechte eines jeden Menschen erklären sollen. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) verstand hierunter den Verlust der ursprünglichen Freiheit . Ein wichtiger Punkt ist, dass hierbei die Entwicklung der Menschheit bzw. die Entwicklung der Zivilisation eine große Rolle spielt. Durch diese Entwicklung setzten die Menschen in den letzten 1.000 Jahren neue Gesetze ein. Diese Gesetze entfremdeten den Menschen von seinem eigenen Ich. Doch auch die zahlreichen Erfindungen in den letzten zwei Jahrhunderten haben ebenfalls zur Entfremdung des Menschen von seiner eigenen Identität beigetragen. Vor allem die maschinelle Produktionsweise hat hierzu beigetragen. Der Philosoph und Anthropologe Ludwig Andreas Feuerbach hingegen sah die Entfremdung der Menschheit schon vor der Industriekultur allein durch die Ansprüche der Religion gegeben. Er ist der Meinung, dass sich der Mensch von seiner eigenen Realität entfremde, von dem, was er vor seinen Augen sieht, und stattdessen seine Ideale auf Gott verlagere, also blind werde.
Der Nationalökonom und Philosoph Karl Marx benutzte den Begriff der Entfremdung erstmals 1844 in seinen ökonomisch-philosophischen Werken. Der wichtigste Punkt liegt hierbei auf der Betonung der Entfremdung durch die eigene Religion (sei es die christliche, die muslimische, die buddhistische oder eine andere). Die Arbeitsteilung führe so zur Entfremdung des Menschen bei der Arbeit. Dies führe zur ökonomischen Entfremdung durch die Arbeit des Menschen. Das Tier wiederum arbeite nur zu einem bestimmten Zweck: Um am Leben zu sein. Es definiere also seine Realität durch pure Existenz. Dies untermauert Marx in folgendem Zitat: Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins. Nur durch diese Form der Arbeit, durch die sich der Mensch ganz wesentlich vom Tier unterscheidet, ist er zu schöpferischer und innovativer Arbeit befähigt [ ] .
Der Mensch plane seine Arbeit und organisiere alles. Er sei derjenige, der allein sein Handeln bestimme und somit auch nach seinen eigenen individuellen Bedürfnissen handle. Wenn dies allerdings nicht der Fall sei, so sei dies laut Karl Marx die entfremdete Arbeit : Die Entfremdete Arbeit kehrt das Verhältnis (menschlicher zu tierischer Tätigkeit) dahin um, dass der Mensch eben, weil er ein bewusstes Wesen ist, seine Lebenstätigkeit, sein Wesen nur zu einem Mittel für seine Existenz macht .
Die Ursachen dieser Entfremdeten Arbeit basieren demnach laut Marx auf der kapitalistischen Arbeitsteilung und auf der Transformation der Arbeitskraft in Ware. Die Entfremdung des Arbeiters vom Produkt ist demnach wichtiger Bestandteil Marx These. Der Gegenstand, den der Mensch produziere, werde zu einer fremden Ware (Warenfetischismus). Der Lohn werde wichtiger als die Arbeit selbst. Der Arbeiter stelle das Produkt zwar her, jedoch besitze er dieses nicht, was dann wiederum zur oben genannten Selbstentfremdung führe. Es sei also der Mensch, der sich durch seine Arbeit nicht verwirklichen könne, schlimmer, er entfremde sich seiner menschlichen Würde und seines menschlichen Bewusstseins und arbeite wie ein Tier. Es entstehe also hier ein Gegensatz zwischen den Menschen, und die früheren zwischenmenschlichen Beziehungen würden aufgehoben.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Subjekt demnach erstens sich innerlich fremd werde bzw. sich von sich selbst trenne, zweitens sein eigenes natürliches Wesen verliere, drittens nicht den
-

- 電子書籍
- 環境計量士(濃度関係)国家試験問題 解…
-

- 和書
- 佐藤泰志作品集