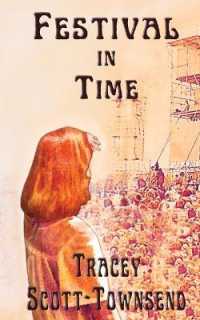Description
(Text)
Auch in Bern hatte sich zu Beginn der 1970er Jahre eine Frauenbewegung herausgebildet. Nach 1975 forderten Aktivistinnen den Feminismus weiter heraus: Nicht nur die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern sollte reflektiert werden, sondern die Diskriminierung lesbischer Frauen in der Gesellschaft und innerhalb der Frauenbewegung musste Gegenstand jeder Frauenbefreiung werden. Waren es nicht gerade lesbische Frauen, welche die Frauenbewegung zu einem grossen Teil trugen? Weshalb war ihre spezifische Situation bisher nicht in den Blick geraten? Das Verhältnis zwischen Lesbianismus und Feminismus bestimmte auch in der Schweiz die innerfeministischer Ausdifferenzierungen in den 1970er Jahren.Am Beispiel dreier Berner Gruppierungen, welche sich auf unterschiedliche Weise für die Emanzipation frauenliebender Frauen einsetzten, wird der subtile Wandel im politischen Selbstverständnis lesbisch-feministischer Akteurinnen zwischen 1975 und 1993 nachgezeichnet. Dieser ermöglicht nicht zuletzt Rückschlüsse auf zentrale Veränderungen in der Frauenbewegung, die sich in den 1970er und 1980er Jahren vollzogen.
(Table of content)
InhaltsverzeichnisDANK1. EINLEITUNG1.1. Fragestellung und Eingrenzung des Gegenstands1.2. Forschungsstand und Quellenlage1.3. Methodisches Vorgehen1.3.1. Interviews als historische Quellen1.3.2. Kontakte und Interviewpartnerinnen1.3.3. Interviewtechnik und Auswertung2. KONZEPTUALISIERUNG "LESBISCH POLITISCHER IDENTITÄTEN"2.1. Identität als historischer Gegenstand2.2. Identität und Politik2.3. "Lesbe" - ein Begriff des 20. Jahrhunderts3. NEUE FRAUEN- UND LESBENBEWEGUNG IN DER SCHWEIZ3.1. Die neue Frauenbewegung nach 19683.2. Die Lesbenbewegung in Zürich3.3. Die Lesbenbewegung in Genf4. LESBISCH-FEMINISTISCH BEWEGTE FRAUEN IN BERN4.1. Lesben Initiative Bern LIB (1977-1980)4.1.1. Zwischen Schwulenbewegung und Frauenbefreiung4.1.2. Identität und Aktion als politische Strategien4.2. Radikalfeministinnen (1976-1983)4.2.1. Separatistischer Feminismus4.2.2. 8. März: "Gegen den Zwang zur Heterosexualität"4.3. "Froueloube" und KultVe im Frauenzentrum (1979-1993)4.3.1. Von der Idee einer Frauenbeiz zum Frauenzentrum4.3.2. Organisation von Restaurant und Frauenzentrum4.3.3. Kultur: ungemischt!5. FAZIT: LESBISCHE FRAUEN IN DER FRAUENBEWEGUNG5.1. Coming-Out als politisierendes Moment5.2. Zur Analyse der Heteronormativität in der Frauenbewegung5.3. Gegenkultur als politische Strategie5.4. Zusammenfassung6. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS7. BIBLIOGRAPHIE7.1. Quellen7.1.1. Ungedruckte Quellen7.1.2. Mündliche Quellen7.1.3. Audio- und audiovisuelle Quellen7.1.4. Gedruckte Quellen7.2. Literatur8. ANHANG: PORTRAITS DER INTERVIEWPARTNERINNEN
(Author portrait)
Ruth Ammann war ursprünglich Architektin, danach wurde sie zur Jungschen Psychoanalytikerin sowie bei Dora Kalff zur Sandspieltherapeutin ausgebildet. Seit 1979 in eigener Praxis tätig, Lehranalytikerin und Dozentin am C.G. Jung Institut in Zürich.