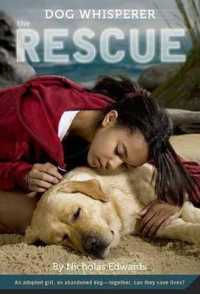Description
(Text)
Der Themenschwerpunkt dieses Jahrbuchs widmet sich unterschiedlichen Bildungs- und Begegnungseinrichtungen deutscher Flüchtlinge und Vertriebener aus dem östlichen Europa, ihrer Bedeutung, Zeichenhaftigkeit und Funktion. Die Beiträge möchten dazu anregen, diese Institutionen, ihre Initiatoren, Träger und Nutzer aus kulturwissenschaftlicher Perspektive künftig stärker in den Blick zu nehmen, wobei sich historische und aktuelle Zugänge gleichermaßen anbieten.
Die zentralen Aufsätze dieser Ausgabe widmen sich, ausgehend von der 2020 an der Johannes Gutenberg Universität Mainz organisierten trinationalen Studienwoche "Sinnliche Zugänge zu symbolischen Orten Vertriebener in Deutschland", der möglichen Transformation von Erinnerungs- zu transnationalen Begegnungsräumen.
Ergänzt werden sie durch Studien zur Tätigkeit deutscher Diakonissen in Pest im 19. Jahrhundert und zur oberbayerischen Flüchtlingsstadt Waldkraiburg sowie Berichte zu einschlägigen Veranstaltungen und aktuellen Buchveröffentlichungen.
(Review)
The thematic contributions in this volume are in conversation with the rich scholarship of the past two decades on sites and practices of expellee commemoration. [...] Read in concert with this literature, the case examples and theoretical observations offered here provide field experts with a sense for how vibrantly the analysis of expellee memory culture has developed over the past two decades, even as the expellees themselves and the exile cultures they formed after 1945 are rapidly passing away. Andrew Demshuk, in: Nordost-Archiv, 32 (2023), S.138-140
(Author portrait)
Dr. Elisabeth Fendl: Studium der Volkskunde und Kunstgeschichte an den Universitäten Regensburg und Marburg (Mag. phil. Regensburg 1986; Dr. phil. Wien 2005). Berufliche Stationen: 2/1989-4/1990 Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Volkskunde an der Universität Regensburg. 6/1990-12/1999 Leiterin des Egerland-Museums in Marktredwitz. Seit 1/2000 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) in Freiburg im Breisgau, dort von 2/2013 bis 1/2016 beurlaubt und Mitarbeiterin der Sudetendeutschen Stiftung als Gründungsbeauftragte für das Sudetendeutsche Museum in München. Seit 2/2016 wieder am IVDE Freiburg. Forschungsschwerpunkte: Erinnerungskultur der Heimatvertriebenen; materielle Kultur und Museum; Geschichte der "ostdeutschen" Volkskunde; Kulturgeschichte der böhmischen Länder.Tobias Weger, Studium der Geschichte sowie Deutschen und vergleichenden Volkskunde in München, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs "Jüdische Stadtgeschichte" am Stadtarchiv München, Kulturreferent für Schlesien am Schlesischen Museum zu Görlitz, Promotion in Geschichte und Habilitation an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, seit 2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg