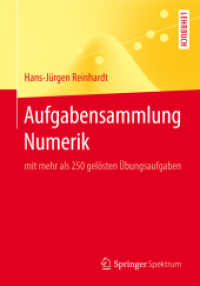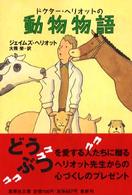Description
(Text)
Die Untreuevorschrift war in Rechtsprechung und Wissenschaft stets Gegenstand von Kritik und Diskussion ber ihre Auslegung und Anwendung. Eine Z sur stellt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23.06.2010 zur Verfassungsm igkeit des Untreuetatbestands und zu den verfassungsrechtlichen Grunds tzen der Auslegung der Untreuevorschrift dar. Pia-Franziska Graf ordnet den Beschluss in die verfassungsrechtlichen Zusammenh nge ein und legt die Konsequenzen der Entscheidung sowohl f r die Untreue- als auch f r die Betrugsstrafbarkeit dar. Die Betrachtung erfolgt f r beide Tatbest nde im Rahmen einer fallgruppenspezifischen Analyse, bei der die f r die jeweilige Fallgruppe ma gebliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fachkundig dargestellt und bewertet wird.
(Table of content)
(Table of content)
Zwischenergebnis dd) Die Grundlage des Verschleifungsverbotsc) Zusammenfassung 2. Die Verpflichtung zur bestimmten Gesetzesauslegunga) Neue Verpflichtungen für die Rechtsprechungaa) Das Präzisierungsgebotbb) Das Rechtsunsicherheitserhöhungsverbotb) Die verfassungsdogmatischen Grundlagenaa) Analogieverbot versus Bestimmtheitsgebotbb) Staatsstrukturprinzipien als verfassungsrechtliche Grenzen für die Kompetenz zur Normgestaltung durch die Judikative(1) Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung(2) Vereinbarkeit mit dem Demokratieprinzipcc) Das Bestimmtheitsgebot als zweiphasiges Modelldd) Ergebnisc) Präzisierung durch eine fallgruppenspezifische Obersatzbildungd) Zusammenfassung3. Die Beachtung des gesetzgeberischen Willens - verfassungsrechtliche Manifestation einer subjektiv-historischen Auslegungszielbestimmung?a) Der Streit um die richtige Auslegungszielbestimmungaa) Die subjektive Theorie bb) Die objektive Theoriecc) Die Position des BVerfGb) Ergebnis4. Das Rückwirkungsverbota) Das bisherige Verständnis des Rückwirkungsverbotsaa) Die bisherige Rechtsprechung und Teile des Schrifttumsbb) Das überwiegende Schrifttumb) Der neue Ansatz des BVerfG - Erhöhung des Vertrauensschutzesc) Würdigungd) ErgebnisC. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Untreuetatbestand und seine AuslegungI. Die Verfassungsmäßigkeit des 266 StGB II. Die untreuespezifischen Anforderungen an eine verfassungskonforme Auslegung1. Die rechtsgutsbezogene Auslegung 2. Die Vermögensbetreuungspflicht3. Die Pflichtverletzunga) Die Umsetzung der negativen Zivilrechtsakzessorietät durch Begrenzung auf vermögensrelevante Verstößeb) Die gravierende Pflichtverletzung als Bewertungsmaßstabc) Die Umsetzung des Verschleifungsverbots d) Zusammenfassung4. Der Vermögensnachteila) Der verfassungsrechtlich gebotene wirtschaftliche Vermögensbegriffb) Der Begriff des Vermögensnachteilsc) Das Prinzip der Gesamtsaldierungd) Objektiv-wirtschaftliche Ermittlung des Vermögensnachteilse) Auswirkungen der wirtschaftlichen Nachteilsermittlung auf unterschiedliche Formen des Vermögensnachteilsaa) Die Vereitelung von Vermögensexspektanzen bb) Die konkrete Vermögensgefahr als Schaden(1) Die Verfassungsmäßigkeit der Figur der konkreten Vermögensgefahr im Lichte der Rechtsprechung des BVerfG (aa) Der Beschluss vom 10. März 2009(bb) Der Beschluss vom 23. Juni 2010(cc) Würdigung der Rechtsprechung des BVerfG (2) Die Nachteilsermittlung und -berechnung im Rahmen der konkreten Vermögensgefahr (3) Die Probleme der bilanzrechtlichen Betrachtung (aa) Die Grundsätze der handelsrechtlichen Bilanzbewertung(bb) Die Gefahr der Förderung der Bereitschaft zur Verfahrensverkürzung (cc) Das bilanzrechtliche Bewertungsverfahren als intuitives Prognoseverfahren(dd) Würdigung (ee) Ergebnis5. Der subjektive TatbestandD. Die erweiterte Prüfungskompetenz des BVerfGI. Erläuterungen des BVerfGII. Reaktionen des SchrifttumsIII. Würdigung E.