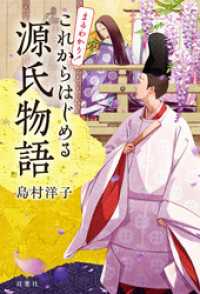- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Social Sciences, Jurisprudence & Economy
- > Jurisprudence & Law
- > general surveys & lexicons
Full Description
Stehen Sie gerade am Anfang eines Jura-Studiums? Oder müssen Sie sich als Nicht-Jurist im Nebenfach mit Jura beschäftigen? Ist Ihnen die juristische Methodik noch fremd und fühlt sie sich für Sie gewöhnungsbedürftig an? Das muss nicht so bleiben! Dieses Buch führt Sie in die Logik der Juristerei ein und erklärt Ihnen in gewohnt verständlicher und anschaulicher Dummies-Manier die Welt der Normengefüge, Sachverhalte und Fallfragen, Auslegung und Fallbearbeitung. Und ganz nebenbei erfahren Sie auch, welche juristischen Todsünden Sie auf keinen Fall begehen sollten.
Contents
Über den Autor 7 Einführung 19
Über dieses Buch 19
Konventionen in diesem Buch 19
Törichte Annahmen über den Leser 20
Wie dieses Buch aufgebaut ist 20
Teil I - Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht 21
Teil II - Von der Werkbank: Das Normengefüge 21
Teil III - Vom Holz: Sachverhalt und Fragestellung 21
Teil IV - Vom Werkzeug: Auslegung und Rechtsfortbildung 21
Teil V - Vom Sägen, Bohren und Hobeln: Technik der Fallbearbeitung 22
Teil VI - Noch ein Blick in die Werkstatt: Der Top-Ten-Teil 22
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden 22
Wie es weitergeht 23
Teil I Vom Zimmern im Allgemeinen: Eine Übersicht 25
Kapitel 1 Methodisch Fälle lösen 27
Regeln sorgen für Ordnung 27
Wie diese Regeln aussehen 28
Wie man diese Regeln anwendet 28
Die Regeln und ihre Ordnung 29
Woher die Regeln kommen 29
Welche Regel Sie nehmen dürfen 30
Was für Regeln es gibt 31
Wie die Regeln ineinandergreifen 31
Sachverhalt und Fragestellung 33
Was ist passiert? 33
Wer will was von wem und wieso? 34
Die Methoden der Rechtsanwendung 35
Was heißt das eigentlich? Auslegung von Gesetzen 35
Was nicht im Gesetz steht? Fortbildung des Rechts 37
Ausfüllen statt auslegen: Der unbestimmte Rechtsbegriff 38
Die Antwort und Ihre Begründung 39
Immer schön logisch ... 39
Immer schön der Reihe nach ... 41
Kapitel 2 Was sind Rechtsnormen und wozu sind sie da? 43
Regeln zum Verhalten 43
Regeln zur Zuweisung von Rechtspositionen 44
Wenn, dann ... - der Aufbau der Norm 45
Kapitel 3 Übersicht über die Fallbearbeitung 47
Anwendung von Normen: Der Rechtssyllogismus 47
Der Syllogismus als klassisches logisches Verfahren 48
Der Rechtssyllogismus als Normanwendung 49
Passt alles? Die Subsumtion 49
Schritt für Schritt: Die Tatbestandsmerkmale 49
Worauf es ankommt: Das Problembewusstsein 52
Und was heißt das nun genau? Die Rechtsfolgenkonkretisierung 52
Rechtsanwendung als komplexe Aufgabe 53
Lösungen zu der kleinen Übung zum Problembewusstsein 54
Teil II Von der Werkbank: Das Normengefüge 55
Kapitel 4 Woher nehmen? Rechtsquellen 57
Schwarz auf weiß: Positives Recht 57
Nationales Recht 58
Internationales Recht 60
Das war schon immer so: Gewohnheitsrecht 61
Keine Rechtsquelle: Richterrecht 62
Urteile als Einzelfallrecht 62
Urteile als Rechtserkenntnisquelle 63
Vom Richterrecht zur Norm 64
Kapitel 5 Welche Norm nehmen? Geltung und Anwendbarkeit 67
Passt das hier überhaupt? Geltung und Anwendbarkeit 67
Geltung 67
Anwendbarkeit 68
Ass sticht König: Geltungsvorrang 69
Normenpyramide 70
Bundesrecht bricht Landesrecht 71
Was passt besser? Konkurrenz von Normen 72
Anwendungsvorrang 72
Rechtsfolgenharmonisierung 75
Echte Konkurrenz 75
Das kann weg! Abdingbarkeit 76
Kapitel 6 Was steht drin? Norminhalte 77
Vollständige und unvollständige Normen 77
Was ist was? Legaldefinitionen 78
Definition als Zwischenschritt der Subsumtion 78
Definitionen im Gesetz 79
Keine Regel ohne Ausnahme: Gegennormen 80
Einwendungen 81
Einreden 82
Ausnahmen: Keine Regel ohne ... 83
Guck doch woanders! Verweisungen 84
Rechtsgrundverweisung und Rechtsfolgenverweisung 84
Verweisungen für Profis: Die entsprechende Anwendung 85
Verweisungsketten: Von Norm zu Norm zu Norm 87
Und übrigens ... : Ausfüllungsnormen 88
Kapitel 7 Wie passt das zusammen? Das Normengefüge als System 89
Fallfrage, Antwortnormen und Hilfsnormen 89
Fragestellung und Antwortnorm 89
Hilfsnormen: Normen, die Sie auch noch brauchen 91
Ein Beispiel und eine kleine Übungsaufgabe 93
Was Sie über das System wissen müssen und was nicht 97
Grundstrukturen des Rechtssystems 97
Aufbauprinzipien und Hilfen beim Suchen 99
Womit Sie Ihr Hirn nicht belasten sollten 99
Lösungen der Aufgaben 100
Teil III Vom Holz: Sachverhalt und Fragestellung 103
Kapitel 8 Was ist passiert? Die prozessuale Wahrheit 105
Wie viel Holz brauchen Sie überhaupt?
Selektive Sachverhaltsermittlung 105
Was Sie nicht wissen müssen 106
Was Sie gar nicht fragen dürfen 107
Wo Sie Ihr Holz suchen: Die Wahrheit im Prozess 109
Was Sie nicht untersuchen müssen 109
Was Sie glauben dürfen 109
Wenn Sie kein Holz finden: Die Feststellungslast 110
Kapitel 9 Wer will was von wem warum? Die Fallfrage 115
Von der Bedeutung der Unzufriedenheit 115
Von der Bedeutung laienhafter Antworten 117
Lösung zur Aufgabe am Schluss von Kapitel 8 118
Kapitel 10 Der mitgeteilte Sachverhalt im Studium 121
Von der Todsünde der Sachverhaltsveränderung 121
Wie Sie in die Falle tappen 121
Wie Sie die Falle vermeiden 123
Von der Auslegung des Sachverhalts 124
Was beiläufig erwähnt wird, ist normal abgelaufen 124
Was nicht geschildert wird, ist nicht passiert 125
Der Aufgabensteller kennt das Recht, die Beteiligten nicht 126
Der Aufgabensteller sagt die Wahrheit, bei den Beteiligten weiß man das nicht 127
Von der Lücke im Sachverhalt 128
Behandlung als unstreitig 129
Alternativlösung 129
Entscheidung nach der Feststellungslast 130
Teil IV Vom Werkzeug: Auslegung und Rechtsfortbildung 131
Kapitel 11 Was im Gesetz steht: Methoden der Auslegung 133
Auslegung und ihre Elemente: Ein Überblick 133
Wann auslegen und wann nicht? 134
Elemente der Auslegung 135
Ausgangspunkt und Grenze der Auslegung: Wortlautargumente 136
Die zwei Funktionen der grammatikalischen Auslegung 136
Der Normadressat als Bezugspunkt der grammatikalischen Auslegung 138
Auslegung anhand des Kontexts: Systematische Argumente 141
Der unmittelbare Kontext 141
Der fernere Kontext 142
Höhere Prinzipien als Kontext 144
Auslegung anhand des Gesetzeszwecks: Teleologische Argumente 148
Wie Sie es richtig machen 148
Wie Sie es falsch machen 150
Auslegung anhand der Textgeschichte: Historische Argumente 153
Was haben die sich denn gedacht? Genetische Argumente 153
Was war denn das Problem? Rechtshistorische Argumente 155
Ergebnis der Auslegung: Abwägung der Argumente 156
Kapitel 12 Was nicht im Gesetz steht: Methoden der Rechtsfortbildung 161
Wenn das Gesetz Löcher hat: Methoden der Gesetzesergänzung 161
Wann ist ein Loch ein Loch? 162
Anwendung einer ähnlichen Regelung: Gesetzesanalogie 168
Anwendung eines allgemeinen Prinzips: Rechtsanalogie 172
Entscheidung nach Gerechtigkeit: Freie Rechtsfortbildung 174
Wenn das Gesetz Fehler hat: Methoden der Gesetzeskorrektur 176
Reine Formulierungsfehler: Kleine berichtigende Auslegung 177
Inhaltliche Irrtümer: Große berichtigende Auslegung 178
Übers Ziel hinausgeschossen: Teleologische Reduktion 179
Wenn das Gesetz unrecht ist: Die Entscheidung gegen das Gesetz 180
Rechtsfortbildung und Gewohnheitsrecht 182
Kapitel 13 Zwischen Auslegung und Rechtsfortbildung: Der unbestimmte Rechtsbegriff 183
Was ist das und wozu taugt es? Von Türchen und Scheunentoren 183
Was macht man damit? Vom Ausfüllen unbestimmter Rechtsbegriffe 185
Ausfüllen als Interessenabwägung 185
Kleine Helferchen des Gesetzgebers 186
Ausfüllen für Profis: Fallgruppenbildung 190
Wie kommen hier die Grundrechte ins Spiel? Vom Grundgesetz als Werteordnung 193
Schutzlücken und Generalklauseln 193
Grundrecht gegen Grundrecht: Praktische Konkordanz 194
Generalklauseln als untaugliche Eingriffsnormen 196
Teil V Vom Sägen, Bohren und Hobeln: Technik der Fallbearbeitung 197
Kapitel 14 Immer schön logisch: Die Denkgesetze 199
Nur was logisch ist, überzeugt 199
Definieren bis zur Evidenz 199
Vollständiges Definieren ist nicht immer nötig 203
Von echter und falscher Evidenz 203
Die Begriffsvertauschung als Todsünde der Falllösung 203
Die Widersprüchlichkeit als Todsünde der Falllösung 205
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten 206
Ohne Umkehrschlüsse geht es nicht 207
Vorsicht mit Umkehrschlüssen! 207
Die unzureichende Begründung 208
Die fehlende Begründung 209
Die leere Begründung 209
Der Zirkelschluss 210
Der logische Bruch 211
Kapitel 15 Immer schön der Reihe nach: Der richtige Aufbau 215
Zwei Aufbauarten: Urteil und Gutachten 215
Urteil und Gutachten im Vergleich 216
Das Gutachten 219
Urteilssätze im Gutachten 222
Zwei Aufbauprinzipien: Logik und Praktikabilität 223
Aufbaulogik: Von der Fallfrage zum Ergebnis 223
Der praktische Aufbau 225
Zwei Möglichkeiten, weniger zu schreiben: Weglassen und Offenlassen 228
Problematische und unproblematische Ergebnisse 229
Weglassen: Zur Argumentation nicht Nötiges 229
Offenlassen: Unproblematisches und Nachrangiges 230
Zwei Möglichkeiten, mehr zu schreiben: Hilfsbegründung und Hilfsgutachten 232
Eine kleine Übersicht zum Weglassen, Offenlassen und zu Hilfserwägungen 234
Kapitel 16 Ihr Fahrplan zur Klausurlösung 237
Erster Schritt: Lesen Sie die Fallfrage! 237
Zweiter Schritt: Lesen Sie den Sachverhalt! 237
Dritter Schritt: Suchen Sie Normen! 238
Vierter Schritt: Wenden Sie die Normen an! 239
Fünfter Schritt: Prüfen Sie Ihr bisheriges Ergebnis auf Plausibilität! 240
Sechster Schritt: Entwerfen Sie den Aufbau Ihrer Lösung! 240
Siebter Schritt: Schreiben Sie die Lösung nieder! 240
Achter Schritt: Fertig! 241
Lösung zur Aufgabe am Schluss von Kapitel 15 241
Teil VI Der Top-Ten-Teil 243
Kapitel 17 Acht wichtige Tipps fürs Fällelösen 245
Kapitel 18 Die sieben Todsünden der Falllösungstechnik 249
Kapitel 19 Dreiunddreißig juristische Begriffe, die Ihnen spanisch vorkommen 251
Stichwortverzeichnis 257