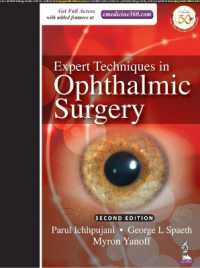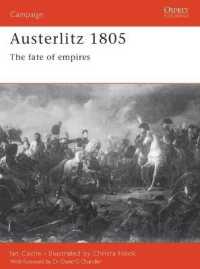- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Mathematics, Sciences & Technology
- > Technology
- > construction & environment engineering
Description
(Text)
Das komplexe und technisch hoch spezialisierte Gebiet der Geotechnik bildet ein Fundament des Bauingenieurwesens, dessen Herausforderungen heute u. a. im innerstädtischen Infrastrukturbau, im Bauen im Bestand oder in der Gestaltung tiefer, in das Grundwasser hineinreichender Baugruben liegen. Das vorliegende Buch befähigt Bauingenieure, grundbauspezifische Probleme zu erkennen und zu lösen. Prägnant und übersichtlich führt es insbesondere in alle wichtigen Methoden der Gründung und der Geländesprungsicherung ein. Auch Themen wie Frost im Baugrund, Baugrundverbesserung und Wasserhaltung werden behandelt. Dem Leser werden bewährte Lösungen für viele Fälle sowie eine große Zahl von Hinweisen auf weiterführende Literatur, insbesondere auf aktuelle Normen und Regelwerke, an die Hand gegeben. Alle Darstellungen basieren auf dem aktuellen technischen Regelwerk. Die Darstellung der Berechnung und Bemessung anhand zahlreicher Beispiele ist eine unverzichtbare Orientierungshilfe in der täglichen Planungs- und Gutachterpraxis.
(Table of content)
Zum Normenhandbuch Eurocode 7
Frost Im Baugrund
Baugrundverbesserung
Flachgründungen
Pfähle
Pfahlroste
Verankerungen
Wasserhaltung
Stützmauern (Gewichtsstützwände)
Spundwände
Pfahlwände
Schlitzwände
Aufgelöste Stützwände
Europäische Normung in der Geotechnik
Literaturverzeichnis
Firmenverzeichnis
(Short description)
The book introduces in particular foundation methods and methods of securing level changes in terrain. The description of calculation and dimensioning with examples are a valuable orientation aid for those working in design and as technical experts.
Contents
Vorwort VII 1 Zum Normenhandbuch Eurocode 7 1 1.1 Allgemeines 1 1.2 Einwirkungen, geotechnische Kenngrossen, Widerstande 2 1.2.1 Einwirkungen. 3 1.2.2 Geotechnische Kenngrossen 4 1.2.3 Widerstande 4 1.3 Charakteristische und reprasentative Werte 4 1.3.1 Charakteristische Werte 4 1.3.2 Reprasentative Werte 5 1.4 Grenzzustande 6 1.5 Bemessungssituationen und Teilsicherheitsbeiwerte 7 1.5.1 Bemessungssituationen 7 1.5.2 Teilsicherheitsbeiwerte 9 1.6 Bemessungswerte 12 1.6.1 Bemessungswerte von Einwirkungen 12 1.6.2 Bemessungswerte von geotechnischen Kenngrossen 13 1.6.3 Bemessungswerte von Bauwerkseigenschaften 13 1.7 Rechnerische Nachweisfuhrung der Tragsicherheit 13 1.7.1 Verlust der Lagesicherheit (EQU) 14 1.7.2 Versagen im Tragwerk und im Baugrund (STR und GEO) 14 1.7.3 Versagen durch Aufschwimmen (UPL) 16 1.7.4 Versagen durch hydraulischen Grundbruch (HYD) 16 1.8 Beobachtungsmethode 17 2 Frost im Baugrund 19 2.1 Allgemeines und Regelwerke 19 2.1.1 Allgemeines 19 2.1.2 Regelwerke 19 2.2 Homogener und nicht homogener Bodenfrost 19 2.3 Frostkriterien 20 2.3.1 Frostempfindliche Boden nach Casagrande 20 2.3.2 Frostkriterien nach Schaible 20 2.3.3 Klassifikation der Frostempfindlichkeit nach DIN 18196 21 2.3.4 Klassifikation der Frostempfindlichkeit nach ZTV E-StB 09 22 2.4 Frosttiefen und frostfreie Grundungen 24 2.5 Frostschaden und Massnahmen zu ihrer Vermeidung 24 2.5.1 Strassenbau und Flugplatzbefestigungen 25 2.5.2 Hochbau 28 2.5.3 Bei Baugruben und Boschungen 29 3 Baugrundverbesserung 31 3.1 Allgemeines und Regelwerke 31 3.1.1 Allgemeines 31 3.1.2 Regelwerke 32 3.2 Verdichtung von Boden 32 3.2.1 Oberflachenverdichtung nichtbindiger Boden 33 3.2.2 Tiefenverdichtung nichtbindiger Boden mit dem Rutteldruckverfahren 35 3.2.3 Oberflachenverdichtung bindiger Boden 37 3.2.4 Verdichtung durch Vorbelastung 38 3.2.5 Vakuumkonsolidierung 40 3.2.6 Verdichtung durch Grundwasserabsenkung 41 3.2.7 Dynamische Intensivverdichtung 42 3.3 Bodenaustauschverfahren 44 3.3.1 Polstergrundung (Bodenteilersatz) 46 3.3.2 Tiefenverdichtung mittels Ruttelstopfverdichtung 46 3.3.3 Geokunststoffummantelte Sandsaulen 48 3.4 Injektionsverfahren 50 3.4.1 DIN-Normen 52 3.4.2 Begriffe 52 3.4.3 Erforderliche Baugrunduntersuchungen 53 3.4.4 Einpresstechnik und Injektionsgerate 54 3.4.5 Verpressvorgang 56 3.4.6 Zementinjektionen 57 3.4.7 Silikatgelinjektionen 59 3.4.8 Kunstharzinjektionen 59 3.4.9 Anwendungsbeispiele 59 3.4.10 Prufung nach DIN 4093 und Uberwachung 61 3.4.11 Standsicherheit von Einpresskorpern im Lockergestein nach DIN 4093 62 3.5 Dusenstrahlverfahren 62 3.5.1 Allgemeines 62 3.5.2 Begriffe nach DIN EN 12716 63 3.5.3 Herstellungsweise und Eigenschaften von Dusenstrahlelementen 64 3.5.4 Anwendungsmoglichkeiten 66 4 Flachgrundungen 68 4.1 Allgemeines und Normen 68 4.1.1 Allgemeines 68 4.1.2 DIN-Normen 68 4.2 Begriffe und Grundlagen 69 4.2.1 Begriffe 69 4.2.2 Untersuchungen des Baugrunds 69 4.2.3 Konstruktionen bei grossen zu erwartenden Setzungsunterschieden 70 4.2.4 Dehnfugen 71 4.3 Entwurf, Auswahl und konstruktive Forderungen 73 4.3.1 Entwurfsgrundlagen 73 4.3.2 Auswahlkriterien 74 4.3.3 Konstruktive Forderungen74 4.4 Einwirkungen und Widerstande 75 4.4.1 Einwirkungen 75 4.4.2 Widerstande des Baugrunds 76 4.5 Aussere Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit 77 4.6 Einzelfundamente 81 4.6.1 Unbewehrte Betonfundamente 82 4.6.2 Stahlbetonfundamente 84 4.6.3 Gestaltung 86 4.6.4 Sohldruckverteilung 88 4.6.5 Biegebemessung von Stahlbetonfundamenten 89 4.6.6 Nachweis gegen Durchstanzen bei Stahlbetonfundamenten 91 4.6.7 Gebrauchstauglichkeitsnachweise nach DIN EN 1992-1-1 95 4.6.8 Vorgefertigte Einzelfundamente 96 4.6.9 Vorgefertigte Kocherfundamente 97 4.6.10 Verankerung von Stahlstutzen 98 4.7 Streifenfundamente 99 4.7.1 Unbewehrte Betonfundamente 100 4.7.2 Stahlbetonfundamente 102 4.7.3 Einseitige Fundamente 104 4.7.4 Bemessungsmomente fur Stahlbetonfundamente 105 4.7.5 Nachweis der Tragfahigkeit fur Querkraft 106 4.7.6 Stahlbetontragerroste 107 4.8 Grundungsbalken 108 4.9 Grundungsplatten 112 4.9.1 Allgemeines 112 4.9.2 Platten konstanter Dicke und ortlich verstarkte Platten 113 4.9.3 Berechnungsverfahren fur Grundungsbalken und -platten 113 4.9.4 Spannungstrapezverfahren, vorgegebene Sohldruckverteilung 115 4.9.5 Verteilung nach Boussinesq, vorgegebene Sohldruckverteilung 116 4.9.6 Belastungsgleiche Verteilung, vorgegebene Sohldruckverteilung 117 4.9.7 Bettungsmodulverfahren, verformungsabhangige Sohldruckverteilung 117 4.9.8 Steifemodulverfahren, verformungsabhangige Sohldruckverteilung 120 5 Pfahle 127 5.1 Allgemeines und Regelwerke 127 5.1.1 Allgemeines 127 5.1.2 Regelwerke 128 5.2 Einteilungen der Pfahle 128 5.2.1 Nach der Art ihrer vorwiegenden Lastabtragung 128 5.2.2 Nach der Lage der tragfahigen Schicht bei Druckpfahlen 129 5.2.3 Nach ihrem Baustoff 129 5.2.4 Nach ihrer Lage im Boden 131 5.2.5 Nach ihrer Herstellung und der Art ihres Einbaus 131 5.2.6 Nach der Art ihrer Beanspruchung 131 5.3 Verdrangungspfahle 132 5.3.1 Begriffe, Einteilung und Herstellgenauigkeit nach DIN EN 12699 132 5.3.2 Reihenfolge des Einbringens, Pfahlabstande und -neigungen 133 5.3.3 Holzpfahle 134 5.3.4 Allgemeines zu Betonfertigpfahlen 136 5.3.5 Vorgefertigte Stahlbetonpfahle 138 5.3.6 Spannbetonpfahle 140 5.3.7 Stahlpfahle 141 5.3.8 Ortbetonpfahle 143 5.3.9 Schraubpfahle 146 5.3.10 Presspfahle 148 5.4 Bohrpfahle 150 5.4.1 Definitionen und Anwendungsbereiche 150 5.4.2 Verrohrtes und ungestutztes Bohren 151 5.4.3 Aufnahme grosser konzentrierter Lasten 152 5.4.4 Schneckenbohrpfahle 153 5.5 Mikropfahle 154 5.5.1 Definitionen und Anwendungsbereiche 154 5.5.2 Systeme 156 5.6 Pfahlkopfanschlusse 158 5.7 Tragverhalten von Pfahlen 160 5.7.1 Inneres Tragverhalten 160 5.7.2 Ausseres Tragverhalten 160 5.8 Tragverhalten von Pfahlen gemass DIN EN 1997-1 162 5.8.1 Allgemeines 162 5.8.2 Einwirkungen und Beanspruchungen 162 5.8.3 Bemessungswerte der Einwirkungen und Beanspruchungen 164 5.8.4 Pfahlwiderstande, Allgemeines 164 5.8.5 Axiale Widerstande aus Ergebnissen statischer Pfahlprobebelastungen 165 5.8.6 Axiale Pfahlwiderstande aus Erfahrungswerten, Allgemeines167 5.8.7 Axiale Widerstande aus Erfahrungswerten fur Bohrpfahle 168 5.8.8 Axiale Widerstande aus Erfahrungswerten fur Fertigrammpfahle 179 5.8.9 Axiale Widerstande aus Erfahrungswerten fur Ortbetonrammpfahle 182 5.8.10 Axiale Widerstande aus Erfahrungswerten fur verpresste Mikropfahle 185 5.8.11 Bemessungswerte der Pfahlwiderstande 186 5.8.12 Nachweis der Tragfahigkeit axial belasteter Einzelpfahle 186 5.8.13 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 188 5.9 Horizontalbelastungen von Pfahlen 191 5.9.1 Aktive Horizontalbelastung 191 5.9.2 Passive Horizontalbelastung 191 5.9.3 Berechnungsmethoden fur Einzelpfahle mit Horizontalbelastung 194 5.9.4 Bettungsmodulverfahren bei Einzelpfahlen 194 5.10 Axial belastete Vertikalpfahlgruppen, ausseres Tragverhalten 195 5.10.1 Wechselwirkung zwischen Einzelpfahlen in Pfahlgruppen 195 5.10.2 Tragfahigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweise nach DIN EN 1997-1 196 5.11 Horizontal belastete Vertikalpfahlgruppen, Einwirkungen und Widerstande 199 5.12 Probebelastung von Pfahlen 204 5.12.1 Allgemeines 204 5.12.2 Widerstands-Setzungs-Linien und Pfahlkopfbewegungen 204 5.12.3 Anzahl der Probepfahle 205 5.12.4 Zeitpunkt der Probebelastung 205 5.12.5 Belastungseinrichtungen fur axiale Probebelastungen 206 5.12.6 Belastungseinrichtungen fur horizontale Probebelastungen 209 5.12.7 Instrumentierung und Messverfahren 210 5.12.8 Verlauf der Probebelastung 211 5.13 Dynamische Integritatsprufung bei Pfahlen 212 6 Pfahlroste 216 6.1 Allgemeines 216 6.2 Einteilungen von Pfahlrosten 216 6.2.1 Tiefe und hohe Pfahlroste 216 6.2.2 Statisch bestimmte Pfahlroste 216 6.2.3 Statisch unbestimmte Pfahlroste 217 6.2.4 Kinematisch unbestimmte Pfahlroste 218 6.3 Kriterien zur Wahl und Anordnung der Pfahlrostpfahle 219 6.4 Pfahlkraftermittlung statisch bestimmter ebener Pfahlroste 220 6.5 Berechnung statisch unbestimmter Pfahlroste 224 6.5.1 Allgemeines 224 6.5.2 Geometrie der axial belasteten Pfahle 224 6.5.3 Einwirkungen auf das System 225 6.5.4 Steifigkeiten der axial belasteten Einzelpfahle 226 6.5.5 Steifigkeitsmatrix des Pfahlrostes 226 6.5.6 Gleichungssystem des Pfahlrostes 227 6.5.7 Berechnung der Pfahlkopfbewegungen und der Pfahlkrafte 227 6.5.8 Pfahlroste mit senkrechten axial belasteten Pfahlen 233 6.5.9 Symmetrische Pfahlroste mit senkrechten axial belasteten Pfahlen 235 6.5.10 Ebene Pfahlroste mit axial belasteten Pfahlen 239 6.5.11 Ebene symmetrische Pfahlroste mit axial belasteten Pfahlen 240 6.5.12 Ebene Pfahlroste mit senkrechten axial belasteten Pfahlen 240 6.5.13 Ebene Pfahlroste mit zwei unter alpha 1 und alpha 2 geneigten Pfahlgruppen 242 6.6 Gelandebruch bei Stutzkonstruktionen mit Pfahlrosten 246 6.7 Ausfuhrungsbeispiele fur Pfahlroste 247 7 Verankerungen 250 7.1 Allgemeines und Regelwerke 250 7.1.1 Allgemeines 250 7.1.2 Regelwerke 251 7.2 Abtragung von Verankerungskraften 251 7.2.1 Abtragung uber Ankerelemente 251 7.2.2 Abtragung uber Bohrlochwand 252 7.3 Begriffe fur Verpressanker 253 7.3.1 Ankerarten 253 7.3.2 Langen 257 7.3.3 Krafte 257 7.4 Korrosionsschutz fur Verpressanker 258 7.4.1 Kurzzeitanker, Verankerungslangen 258 7.4.2 Kurzzeitanker, freie Stahllangen 259 7.4.3 Kurzzeitanker, Ubergang freie Stahllange zur Verankerungslange 260 7.4.4 Kurzzeitanker, Ankerkopfbereich 260 7.4.5 Daueranker; Allgemeines 261 7.4.6 Daueranker, Verankerungslangen und freie Stahllangen 261 7.4.7 Daueranker, Ankerkopfbereich 262 7.5 Herstellung von Verpressankern 263 7.5.1 Bohrlocher 263 7.5.2 Einbau, Verpressung und Nachverpressung 264 7.6 Verpressankerbemessung und -nachweise 267 7.6.1 Allgemeines 267 7.6.2 Einwirkungen und Beanspruchungen 267 7.6.3 Widerstande 268 7.6.4 Nachweis der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit 269 7.7 Prufungen von Verpressankern gemass DIN EN 1537 270 7.7.1 Untersuchungsprufung 271 7.7.2 Eignungsprufung 272 7.7.3 Abnahmeprufung 272 7.7.4 Nachprufung 273 7.8 Herauszieh-Widerstande und Kriechmass 273 7.8.1 Herauszieh-Widerstande beim Bruch in nichtbindigen Boden 273 7.8.2 Herauszieh-Widerstande beim Bruch in bindigen Boden 275 7.8.3 Herauszieh-Widerstand Ra, k und Kriechmass ks 276 7.9 Voraussetzungen fur die Verwendung von Verpressankern 279 7.10 Wahl geeigneter Ankersysteme 280 7.11 Entwurfsregeln fur Verpressankerlange und - anordnung 280 7.12 Standsicherheit des Gesamtsystems bei Ankergruppen 283 7.12.1 Verankerung ausserer Lasten 283 7.12.2 Verankerte Baugrubenwande (tiefe Gleitfuge) 285 8 Wasserhaltung 290 8.1 Allgemeines und Regelwerke 290 8.2 Grundwasserstromung 291 8.2.1 Voraussetzungen und Begriffe 291 8.2.2 Stromungsgleichung von Laplace 292 8.2.3 Stromungsnetze 293 8.2.4 Grundwasserstromung und Bodenwichte 297 8.3 Hydraulischer Grundbruch 299 8.3.1 Allgemeines 299 8.3.2 Sicherheitsnachweis nach Baumgart/Davidenkoff 300 8.3.3 Naherungsformel von Kastner 302 8.3.4 Sicherheitsnachweis nach Terzaghi/Peck 305 8.3.5 Sicherheitsnachweis nach DIN 1054 306 8.3.6 Sicherheitsnachweise nach EAU und EAB 307 8.3.7 Sicherheitsnachweise fur Baugruben mit Bemessungsdiagrammen 308 8.3.8 Senkrechte Durchstromung von horizontal geschichtetem Boden 309 8.3.9 Berucksichtigung von Bodenschichtungen 310 8.3.10 Sicherungsmassnahmen 311 8.4 Erosionsgrundbruch 312 8.5 Verfahren der Wasserhaltung 314 8.6 Schwerkraftentwasserung 315 8.6.1 Allgemeines 315 8.6.2 Offene Wasserhaltung315 8.6.3 Horizontalabsenkung 316 8.6.4 Brunnenabsenkung 317 8.6.5 Flachbrunnenanlagen 318 8.6.6 Wellpointanlagen 320 8.6.7 Tiefbrunnenanlagen 321 8.7 Unterdruckentwasserung 322 8.7.1 Allgemeines 322 8.7.2 Spulfilteranlagen 323 8.7.3 Tiefbrunnenanlagen 324 8.8 Gesetz von Darcy, Gultigkeitsgrenzen 325 8.9 Arten von Grundwasserleitern 327 8.9.1 Grundwasserleiter mit freier Grundwasseroberflache 327 8.9.2 Grundwasserleiter mit gespanntem Grundwasser 327 8.10 Berechnungsformeln 328 8.10.1 Zufluss zu einem Schlitz, Formel von Dupuit 328 8.10.2 Offene Wasserhaltung 329 8.10.3 Brunnenformel von Dupuit-Thiem, Voraussetzungen 331 8.10.4 Brunnenformel von Dupuit-Thiem bei freier Grundwasseroberflache 331 8.10.5 Brunnenformel von Dupuit-Thiem bei gespanntem Grundwasser 333 8.10.6 Fassungsvermogen von Einzelbrunnen 335 8.10.7 Reichweite R der Absenkung bei vollkommenen Einzelbrunnen 338 8.10.8 Mehrbrunnenformel von Forchheimer 339 8.10.9 Von Brunnen umschlossene Baugrube 341 8.10.10 Benetzte Filterflachenhohe h' eines Anlagebrunnens 342 8.10.11 Unvollkommene Brunnen 347 8.10.12 Einfluss der Eintauchtiefe von wasserdichten Baugrubenwanden348 8.10.13 Durchlassigkeitsbeiwert, Probewasserabsenkung 349 9 Stutzmauern (Gewichtsstutzwande) 351 9.1 Allgemeines 351 9.2 Regelwerke und Begriffe 351 9.2.1 Regelwerke 351 9.2.2 Begriffe 352 9.3 Bedingungen und Gesichtspunkte beim Entwurf 352 9.3.1 Allgemeine Bedingungen352 9.3.2 Konstruktive Gesichtspunkte353 9.4 Stutzmauertypen 354 9.4.1 Futtermauern 354 9.4.2 Trockengewichtsmauern355 9.4.3 Schwergewichtsmauern355 9.4.4 Winkelstutzmauern 356 9.5 Einwirkungen und Widerstande 356 9.5.1 Auf Schwergewichtsmauern einwirkender Erddruck. 357 9.5.2 Auf Winkelstutzmauern einwirkender Erddruck 358 9.5.3 Wasserdruck auf Stutzmauern366 9.5.4 Widerstande 366 9.6 Nachweis der Tragfahigkeit 367 9.6.1 Gleitsicherheit 367 9.6.2 Grundbruchsicherheit 368 9.6.3 Kippsicherheit 370 9.6.4 Materialversagen bei Schwergewichtsmauern 370 9.6.5 Nachweis fur die Grenzzustande HYD und GEO-3 371 9.7 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 372 9.7.1 Zulassige Lage der Sohldruckresultierenden 372 9.7.2 Unzutragliche Verschiebungen und unzulassige Setzungen 375 9.8 Entwasserung 375 9.8.1 Belastungen von Stutzmauern 375 9.8.2 Anordnung von Dranageeinrichtungen 376 9.8.3 Anforderungen an Draneinrichtungen 377 9.8.4 Bedingungen fur die Ausfuhrung von Sickeranlagen 378 9.8.5 Ableitung von Oberflachenwasser 380 10 Spundwande 381 10.1 Allgemeines und Regelwerke 381 10.1.1 Allgemeines 381 10.1.2 Regelwerke 382 10.2 Einsatz von Stahlspundwanden 383 10.2.1 Einsatzvorteile 383 10.2.2 Vergleich mit anderen Stutzkonstruktionen 383 10.2.3 Mogliche Querschnittsschwachungen 384 10.2.4 Zusatzliche Dichtungsmassnahmen 386 10.3 Profile von Stahlspundwanden 387 10.4 Einbringung von Stahlspundbohlen 390 10.4.1 Rammen 391 10.4.2 Einrutteln 392 10.4.3 Einpressen 394 10.4.4 Einstellen in Schlitzwande 395 10.5 Berechnung von Spundwanden 396 10.5.1 Vorbemerkungen 396 10.5.2 Einwirkungen bei Baugruben 397 10.5.3 Grundformen der Spundwandbewegung und Erddruckverteilung 399 10.5.4 Abhangigkeiten der Erddruckkraftgrosse gemass EAB 400 10.5.5 Neigungswinkel des Erddrucks gemass EAB und EAU 401 10.5.6 Aktive Erddruckkraft bei unbelasteter Gelandeoberflache gemass EAB 402 10.5.7 Aktive Erddruckverteilung bei unbelasteter Gelandeoberflache nach EAB 403 10.5.8 Aktive Erddruckkraft aus Nutzlasten gemass EAB 404 10.5.9 Aktive Erddruckverteilung aus Nutzlasten nach EAB 406 10.5.10 Vereinfachte Lastfiguren gestutzter Wande nach EAB 406 10.5.11 Passive Erddruckverteilung im Einbindebereich der Wand nach EAB 407 10.5.12 Vereinfachte Lastfiguren von Spundwanden nach EAB 408 10.5.13 Baugruben im Wasser 409 10.5.14 Lastbilder fur Spundwande im Wasser 410 10.5.15 Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1, DIN 1054 und EAB411 10.5.16 Erforderliche Einbindetiefe von Spundwanden 413 10.5.17 Erforderliche Einbindetiefe mit dem Lastansatz von Blum 415 10.5.18 Inneres Gleichgewicht der Vertikalkrafte 423 10.5.19 Ausseres Gleichgewicht der Vertikalkrafte (Versinken der Wand)424 10.5.20 Gebrauchstauglichkeitsnachweis nach E DIN 1997-1, DIN 1054 und EAB 427 11 Pfahlwande 428 11.1 Allgemeines 428 11.2 Anwendungsbereiche 429 11.3 Regelwerke 430 11.4 Wandtypen 430 11.4.1 Aufgeloste Pfahlwande 431 11.4.2 Tangierende Pfahlwande 432 11.4.3 Uberschnittene Pfahlwande 433 11.5 Herstellung 434 11.5.1 Bohrschablonen 434 11.5.2 Wande 435 11.6 Tragverhalten 437 11.7 Bemessung 438 11.7.1 Bemessung der Spritzbeton-Ausfachungen 438 11.7.2 Bemessung von Verankerungen 438 12 Schlitzwande 439 12.1 Allgemeines 439 12.2 Anwendungsbereiche 440 12.3 Regelwerke und Begriffe 441 12.3.1 Regelwerke 441 12.3.2 Begriffe 441 12.4 Aushubwerkzeuge 443 12.4.1 Schlitzwandgreifer 443 12.4.2 Schlitzwandfrasen 444 12.5 Herstellungsverfahren 445 12.5.1 Zweiphasenverfahren 446 12.5.2 Einphasenverfahren 446 12.5.3 Kombinationsverfahren446 12.6 Herstellung von Schlitzwanden 447 12.6.1 Leitwande 450 12.6.2 Schlitzaushub 451 12.6.3 Betonieren 453 12.7 Tonsuspensionen, Fliessgrenze und thixotrope Verfestigung 454 12.8 Ubertragung des Stutzflussigkeitsdrucks 455 12.8.1 Entstehung von vollkommenen Filterkuchen 455 12.8.2 Reine Eindringung (fehlender Filterkuchen) 456 12.8.3 Unvollkommene Filterkuchenbildung und verminderte Eindringung 457 12.8.4 Geschlossene Systeme 458 12.8.5 Druckgefalle 459 12.9 Standsicherheit des gestutzten Schlitzes 460 12.9.1 Zutritt von Grundwasser in den Schlitz 460 12.9.2 Innere Standsicherheit 465 12.9.3 Unterschreiten des statisch erforderlichen Stutzflussigkeitsspiegels 469 12.9.4 Aussere Standsicherheit, Allgemeines 470 12.9.5 Aussere Standsicherheit, Stutzkraft 473 12.9.6 Aussere Standsicherheit, Erddruckkraft 477 12.9.7 Aussere Standsicherheit, Falle ohne erforderlichen Nachweis 480 12.10 Standsicherheit der erharteten Wand 482 13 Aufgeloste Stutzwande 484 13.1 Allgemeines 484 13.2 Zulassige Boschungswinkel nach DIN-Normen 485 13.2.1 DIN 4084, DIN 1054 und DIN EN 1997-1/NA 485 13.2.2 DIN 4124 488 13.3 Grundlagen 493 13.4 Raumgitterwande 494 13.4.1 Allgemeines 494 13.4.2 Regelwerke 494 13.4.3 Begriffe 494 13.4.4 Einsatzvorteile und Anwendungsbereiche 495 13.4.5 Planung und Gestaltung 496 13.4.6 Grundung 497 13.4.7 Verfull- und Hinterfullboden 498 13.4.8 Verformungen der Wand 498 13.4.9 Einwirkungen auf Gesamtbauwerk 499 13.4.10 Einwirkungen an den Raumgitterzellen 500 13.4.11 Nachweise zur ausseren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 501 13.4.12 Nachweise zur inneren Standsicherheit 502 13.5 Bewehrte Erde 505 13.5.1 Allgemeines 505 13.5.2 Regelwerke 506 13.5.3 Konstruktionsprinzip 506 13.5.4 Anforderungen an den Fullboden508 13.5.5 Anforderungen an den Hinterfull- und Uberschuttboden 510 13.5.6 Anforderungen an die Bewehrungsbander 510 13.5.7 Anforderungen an die Aussenhaut 511 13.5.8 Nachweise zur ausseren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 511 13.5.9 Innere Standsicherheit, Nachweis der Bewehrungsbander 514 13.5.10 Innere Standsicherheit, Nachweis der Anschlusse an die Aussenhaut 518 13.6 Bewehrung mit Geokunststoffen 519 13.6.1 Allgemeines 519 13.6.2 Regelwerke 520 13.6.3 Einteilung von Geokunststoffen520 13.6.4 Einsatzgebiete von Geokunststoffen 521 13.6.5 Allgemeines und Begriffe zum Bewehren mit Geokunststoffen 522 13.6.6 Anforderungen an das Material bewehrter Konstruktionen 523 13.6.7 Konstruktive Gestaltung und Herstellung bewehrter Gelandesprunge 525 13.6.8 Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit bei Stutzkonstruktionen 527 13.6.9 Tragfahigkeitsnachweise (um Stutzkonstruktion verlaufende Gleitlinien) 528 13.6.10 Tragfahigkeitsnachweise (durch Stutzkonstruktion verlaufende Gleitlinien) 529 13.6.11 Nachweis der Frontausbildung 532 13.7 Bodenvernagelung 533 13.7.1 Allgemeines 533 13.7.2 Regelwerke 536 13.7.3 Konstruktionsprinzip und Herstellung 537 13.7.4 Vorteile und Grenzen der Anwendung 540 13.7.5 Trag- und Verformungsverhalten 542 13.7.6 Nachweis der ausseren Standsicherheit 542 13.7.7 Nachweis der inneren Standsicherheit, Regelprofil 544 13.7.8 Nachweis der inneren Standsicherheit mit zwei starren Bruchkorpern 545 13.7.9 Bemessung der Spritzbetonschale 548 14 Europaische Normung in der Geotechnik 549 14.1 Allgemeines 549 14.2 Deutsche und europaische Normung 549 14.3 Eurocode 7 551 14.3.1 Nationaler Anhang (NA) 551 14.3.2 DIN EN 1997-1 erganzende Deutsche Normen und Empfehlungen 552 14.4 Europaische geotechnische Ausfuhrungsnormen 552 14.5 Weitere europaische geotechnische Normen 553 14.6 Bauaufsichtliche Einfuhrung 553 14.6.1 Allgemeines 553 14.6.2 Ubergang von deutscher auf europaische Normung 555 Literaturverzeichnis 556 Firmenverzeichnis 576 Stichwortverzeichnis 579 Inserentenverzeichnis 594