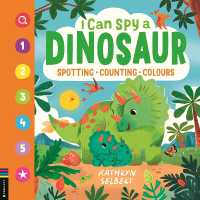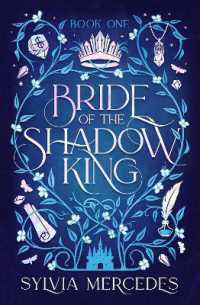Description
(Short description)
Textdivergenzen in mehrsprachigen völkerrechtlichen Verträgen können den Rechtsanwender vor erhebliche Auslegungsprobleme stellen. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung der Staats- und Gerichtspraxis des 18. und 19. Jahrhunderts. Des Weiteren wird auf die Implikationen des Fragmentierungsdiskurses im Völkerrecht sowie die internationale und deutsche Gerichtspraxis zu Artikel 33 der Wiener Vertragsrechtskonvention eingegangen.
(Text)
Da völkerrechtliche Verträge in der Regel nicht nur in einer, sondern in mehreren Sprachen abgefasst sind, können sich bei der Auslegung besondere praktische Probleme ergeben, insbesondere wenn die verschiedensprachigen Texte inhaltlich nicht exakt übereinstimmen. Diese Probleme wurden in Artikel 33 der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 aufgegriffen, welcher hierzu völkervertragliche Auslegungsregeln bereithält. Die vorliegende Arbeit versucht erstmals, die Auslegung mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge anhand der historischen Völkerrechtspraxis rechtsquellensystematisch aufzuarbeiten und die hierbei gewonnenen Erkenntnisse im Verhältnis zur Darstellung des Art. 33 WVK einfließen zu lassen. Die Arbeit geht weiter auf die Implikationen des völkerrechtlichen Fragmentierungsdiskurses sowie die Anwendung von Art. 33 WVK im innerstaatlichen Bereich ein und schließt mit einem Plädoyer für mehr Fremdsprachenkompetenz als notwendige juristische Qualifikation.
(Table of content)
1. Teil: Die Sprache als Kommunikationsmedium und Konfliktpotential im VölkerrechtEinführung in die Thematik - Mehrsprachigkeit als Problemstellung bei der Ausarbeitung mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge2. Teil: Die Auslegung mehrsprachiger Verträge als Schnittbereich der allgemeinen Hermeneutik und der JurisprudenzAuslegung völkerrechtlicher Verträge - Die Auslegungsregeln bei mehrsprachigen völkerrechtlichen Verträgen - Zusammenfassung3. Teil: Die Bedeutung von Art. 33 WVK für die Auslegung mehrsprachiger VerträgeDie Auslegung mehrsprachiger Verträge nach Inkrafttreten der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 - Der Wert von Art. 33 WVK als Auslegungsvorschrift für mehrsprachige völkerrechtliche Verträge4. Teil: Die Auslegung mehrsprachiger Verträge im Lichte der Fragmentierung des VölkerrechtsDie Fragmentierung des Völkerrechts und die Auslegung mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge - Die Auslegung mehrsprachiger menschenrechtlicher Verträge - Die Auslegung mehrsprachiger wirtschaftsvölkerrechtlicher Verträge - Schlussfolgerungen aus der Fragmentierung des Völkerrechts für die Auslegung mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge5. Teil: Die Auslegung mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge auf innerstaatlicher Ebene am Beispiel der Bundesrepublik DeutschlandDie Frage des innerstaatlich verbindlichen Vertragstextes - Die Heranziehung fremdsprachiger Vertragstexte als Herausforderung für den innerstaatlichen Richter6. Teil: Schlussteil und Ausblick: Das Spannungsfeld von Jurisprudenz und FremdsprachenkompetenzNeubewertung der Fremdsprachenkompetenz als unabdingbare Qualifikation des Richters - Zusammenfassende Thesen - Summarizing ThesesLiteratur- und Stichwortverzeichnis
(Review)
»Benedikt Nehls hat mit seiner Dissertationsschrift eine starke Referenz gesetzt, die von der Völkerrechtswissenschaft nicht ignoriert werden kann. Die Erkenntnisse seiner Arbeit sind maßstabsbildend. Zugleich ist das Thema damit nicht ausgeschöpft, sondern bildet erst die Basis für weitere spezialisierte Forschung auf verschiedenen besonderen Gebieten des Völkerrechts und des deutschen Verfassungsrechts. Mehr Fruchtbarkeit für die Wissenschaft kann man von einer Dissertationsschrift nicht verlangen. Da die Arbeit von Nehls zugleich in gedanklicher und sprachlicher Hinsicht herausragt, sei ihre Lektüre auch einem größeren Kreis als dem der eigentlich adressierten Völkerrechtsgemeinde wärmstens empfohlen.« Dr. Björn Schiffbauer, in: Archiv des Völkerrechts, Bd. 58, Heft 2/2020