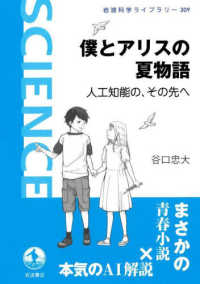Description
(Short description)
Über die Gültigkeit der Ehe entschied in der Frühen Neuzeit eine Vielzahl an Normen, Gewohnheiten und Gesetzen, die miteinander nicht vereinbar waren. Wie gingen die Zeitgenossen mit Konflikten in der prekären Phase der Eheanbahnung um, wenn das Recht keine einheitliche Regelung vorsah? Die Diversität des frühneuzeitlichen Eherechts erweiterte die Spielräume für die Aushandlung sozialen Friedens.
(Text)
In der Frühen Neuzeit war die Frage, auf welche Weise die Ehe rechtswirksam geschlossen wurde, äußerst umstritten. Im Unterschied zur heutigen Zivilehe gab es keinen singulären Rechtsakt, der darüber entschied, ab welchem Zeitpunkt eine Ehe gültig war. Vielmehr konnten viele unterschiedliche, auch widersprüchliche und uneindeutige Normen bei der Eheschließung wirksam werden: geschriebene ebenso wie ungeschriebene, geistliche ebenso wie weltliche, landesherrliche ebenso wie städtische. Je nach normativer Grundlage entschied entweder das Gelöbnis der Brautleute, der Beischlaf, der Konsens der Eltern, der Tausch von Geschenken, das gemeinsame Mahl oder die kirchliche Trauung über die Rechtmäßigkeit der Ehe. Am Beispiel der frühneuzeitlichen Grafschaft Lippe untersucht Iris Fleßenkämper, wie die Zeitgenossen mit der Vielfalt an Regelungsmöglichkeiten in einem Lebensbereich umgingen, der grundlegend für die Aufrechterhaltung der familiären und sozialen Ordnung war.
(Review)
»Mit ihrer Studie schließt Iris Fleßenkämper eine wichtige Forschungslücke, indem sie auf breiter Quellenbasis und methodisch durchdacht nicht nur frühneuzeitliche Normen und Praktiken der Eheschließung minutiös zusammenträgt, sondern sie darüber hinaus in ihrem lebensweltlichen Zusammenhang von Ehekonflikten und deren Aushandlung außerhalb oder innerhalb von Gerichten setzt.«
John Egle, H-Soz-Kult, 20.05.2025
(Author portrait)
Iris Fleßenkämper ist seit Oktober 2021 Sekretarin des Wissenschaftkolleg zu Berlin. Zuvor war sie von 2007 bis 2021 wissenschaftliche Geschäftsführerin des Exzellenzclusters "Religion und Politik" der WWU Münster.Ulrike Ludwig ist Universitätsprofessorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der WWU Münster und Ko-Direktorin des Käte Hamburger-Kollegs "Einheit und Vielfalt im Recht".