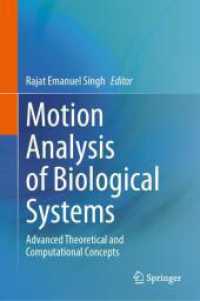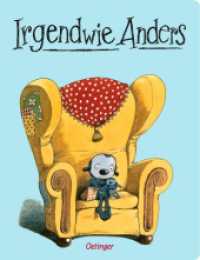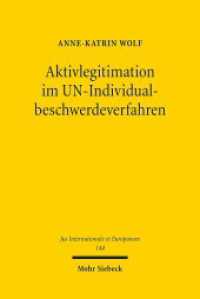- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Social Sciences, Jurisprudence & Economy
- > Jurisprudence & Law
- > general surveys & lexicons
Description
(Text)
Das römische Erbrecht kennt nicht nur die Erbeinsetzung von freien Personen, sondern auch von Sklaven. Besonders vielschichtig stellt sich dabei die Einsetzung fremder Sklaven dar. In diesem Falle wird der Sklave zwar Erbe, doch fällt das Vermögen an seinen Herrn. Aus dieser Aufspaltung von Erbenstellung und Vermögenserwerb ergeben sich zahlreiche Fragestellungen, die in der vorliegenden Monographie erstmals im Zusammenhang untersucht werden. Die Darstellung umfasst nicht nur die erbrechtliche Problematik, sondern auch die soziale Situation des zum Erben eingesetzten fremden Sklaven. Dabei zeigt sich, dass Sklaven, obwohl sie nicht rechtsfähig waren, dennoch von der Erbeinsetzung profitieren konnten. Das Buch deckt aber auch die weiteren Ursachen und die Strategien der erbrechtlichen Vermögensnachfolge auf, welche diesem - auffallend häufigen - Phänomen der römischen Rechts- und Sozialordnung zugrunde lagen.
(Author portrait)
Buchwitz, WolframWolfram Buchwitz ist Ordinarius für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, Historische Rechtsvergleichung und Zivilprozessrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt.Buchwitz, Wolfram Wolfram Buchwitz ist Ordinarius für Bürgerliches Recht, Römisches Recht, Historische Rechtsvergleichung und Zivilprozessrecht an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt.
(Table of content)
Erbantritt, Erbschaftserwerb
1.2 Ausfall eines Miteigentümers: Erwerb durch die Übrigen
1.3 Rechtsgrund des Erwerbs der Miteigentümer
1.4 Ausfall eines Miteigentümers: Erwerb durch den
Ersatzerben
1.5 Ergebnis
2. Einsetzung durch einen Miteigentümer
2.1 Ohne Freiheitserteilung
2.1.1 Der Sklave ist Alleinerbe
2.1.2 Der Sklave ist Miterbe
2.2 Mit Freiheitserteilung
2.2.1 Der Sklave ist Alleinerbe
2.2.2 Der Sklave ist Miterbe
2.3 Ergebnis
2.4 Sonderfälle
2.4.1 Irrtum bei Einsetzung
2.4.2 Umfassende Wirksamkeit der Einsetzung mit Freiheitserteilung
3. Parallele beim Vermächtnis
3.1 Der Grundsatz nach spätklassischem Recht
3.2 Der Meinungsstreit im frühklassischen Recht
3.2.1 Das Sachproblem
3.2.2 Die Juristen
3.2.3 Die Ansicht des Sabinus
3.3 Die Rolle von Julian und Paulus
3.4 Ergebnis
4. Auswirkungen der Veräußerung oder Freilassung
4.1 Veräußerung oder Freilassung ohne Ersatzerben
4.2 Problem der Ersatzerbschaft
Kapitel 6: Vermächtnisse zugunsten von Herrn und Sklaven
1. Grundsätze und getrennter Erwerb
2. Sonderfälle beim Sklavenerwerb
2.1 Die Problematik bei Paulus 12 quaest. D. 35,2,21,1
Exkurs: Freilassungsfideikommisse
2.2 Ein Freilassungslegat in D. 35,2,21,1
2.3 Geldvermächtnis an einen zur Freilassung vermachten
Sklaven
3. Ergebnis
ZWEITER TEIL
GRÜNDE FÜR DIE ERBEINSETZUNG:
BEGÜNSTIGUNG DES SKLAVEN
Kapitel 7: Vermögenserwerb des freigelassenen Sklaven
1. Erwerb durch bedingte Erbeinsetzung
2. Erwerb durch Fideikommiss
3. Erwerb durch Kombination
Kapitel 8: Vermögenserwerb des Sklaven
1. Bedeutung der Person des Sklaven
1.1 Vermächtnis einer eigenen Sache
1.2 Vermächtnis eines Wegerechts
1.3 Alimentslegat
2. Bedeutung des Willens des Erblassers zur Begünstigung
bestimmter freier Personen
2.1 Einsetzung eines Dotalsklaven
2.2 Einsetzung eines zu restituierenden Sklaven
3. Bedeutung des Willens des Erblassers zur