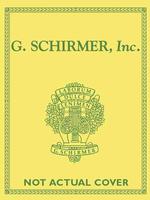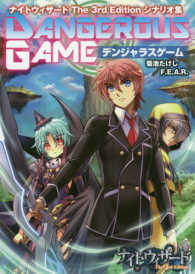Full Description
Die Lehre des Risk Managements versucht, nicht nur die Folgen von Gefahren abzuschwachen, sondern auch gezielt Ursachen anzugehen. Die normative Entscheidungstheorie dient dabei als Hilfswissenschaft bei der Suche nach den jeweils optimalen ursachen- und wirkungsbezogenen Massnahmen. Das Grundmodell der Entscheidungstheorie aber enthalt die sehr restriktiven Forderungen nach der "Aktionsunabhangigkeit" der Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustande. Um auch ursachenbezogene Massnahmen beurteilen zu konnen, werden Modellkonzeptionen, die diese Forderung nicht enthalten, verwendet. Ariane Motsch zeigt nun,dass die Forderung nach Aktionsunabhangigkeit durchaus sinnvoll sein kann. Bei Berucksichtigung unscharfer Wahrscheinlichkeitsinformationen kann namlich nur eine Modellkonzeption , die diese Forderung erfullt, eine vollstandige Informationsverwertung garantieren. Verzeichnis: Das Grundmodell der Entscheidungstheorie enthalt die sehr restriktive Forderung nach der "Aktionsunabhangigkeit" der Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustande. Es wird gezeigt nun, dass diese Forderung durchaus sinnvoll sein kann.
Bei Berucksichtigung unscharfer Wahrscheinlichkeitsinformationen kann namlich nur eine Modellkonzeption, die diese Forderung erfullt, eine vollstandige Informationsverwertung garantieren.
Contents
1 Einführung.- 1.1 Charakteristische Merkmale einer Entscheidungssituation.- 1.2 Darstellung in der normativen Entscheidungstheorie.- 1.3 Aufbau der Arbeit.- 2 Modellkonzeptionen der normativen Entscheidungstheorie.- 2.1 Präferenzrelationen.- 2.2 Entscheidungsregeln.- 2.3 Risikonutzentheorie — Anforderungen an ein rationales Verhalten.- 2.4 Subjektive Wahrscheinlichkeiten.- 2.5 Erwartungsnutzentheorie von Savage.- 2.6 Aktionsabhängigkeit der Umweltzustände.- 2.7 Erwartungsnutzentheorien von Fishburn/ Balch.- 3 Beurteilung der Anforderungen der normativen Entscheidungstheorie an den Entscheidungsträger.- 3.1 Argumente gegen die normative Entscheidungstheorie.- 3.2 Rationalitätsverständnis der normativen Entscheidungstheorie.- 3.3 Nähere Betrachtung der Kernargumente gegen die Risikonutzentheorie und ihre zugrundeliegenden Axiome.- 3.4 Spezielle Bedingungen bei Savage's und Fishburn/ Balch's Axiomatik.- 3.5 Modellformulierung im Sinne der Fuzzy-Entscheidungstheorie.- 3.6 Stellenwert empirischer Untersuchungen der Erwartungsnutzentheorie.- 3.7 Training von rationalem Entscheidungsverhalten.- 3.8 Fazit.- 4 Lineare Partielle Information (LPI): Ein Zugeständnis an die oft beschränkten Informationen des Entscheidungsträgers.- 4.1 Problemstellung.- 4.2 Subjektivistische und objektivistische Wahrscheinlichkeitsauffassung.- 4.3 Grundbegriffe der LPI-Theorie.- 4.4 Das 'states-of-the-world' — Modell bei LPI.- 4.5 Das Basismodell von Fishburn bei LPI.- 4.6 Entscheidungsregeln bei LPI.- 4.7 Gemischte Aktionen bei LPI.- 4.8 Einholung zusätzlicher Information.- 5 Gegenüberstellung der Modellkonzeptionen von Savage und Fishburn.- 5.1 Wiederherstellung der Aktionsunabhängigkeit durch formale Umformung des Basismodells von Fishburn in das verallgemeinerteSavage-Modell.- 5.2 Verschiedene Arten von Dominanzprinzipien.- 5.3 Verwertbarkeit von Informationen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände als Effizienzkriterium einer Modellkonzeption.- 5.4 Gemischte Aktionen bei Vorliegen von LPI und aktionsabhängigen Umweltzuständen.- 5.5 Vor- und Nachteile der jeweiligen Modellkonzeptionen.- 5.6 Implikationen für das Risk Management.- 6 Resümé.- 6.1 Ordnungsschema der Modellkonzeptionen.- 6.2 Möglichkeiten einer EDV-Unterstützung.- Autorenverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.