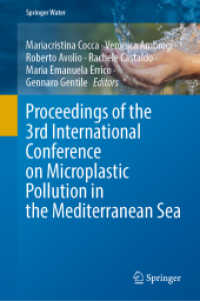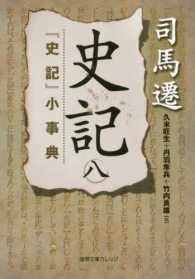Description
(Text)
Mit zunehmender Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes kam es nicht nur zu vielfältigen Erleichterungen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs. Da es nicht zugleich gelang, das umsatzsteuerliche Ursprungslandprinzip zu verwirklichen, sondern am Bestimmungslandprinzip festgehalten wurde, musste für umsatzsteuerliche Zwecke ein alternatives Kontrollsystem zu den weggefallenen physischen Grenzkontrollen geschaffen werden. Schließlich gilt es im weitesten Sinne, die Umsatzsteuerbefreiung des innergemeinschaftlich liefernden Unternehmens durch die korrespondierende Besteuerung des Erwerbers zu neutralisieren. Der deutsche Gesetzgeber kodifizierte dazu nicht nur umfassende Nachweispflichten, sondern auch eine Gutglaubensschutzvorschrift. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die nationalen Regelungen sowie die dazu ergangene finanzgerichtliche Rechtsprechung daraufhin zu analysieren, ob sie im Einklang mit den Vorgaben der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, also den europa- und mehrwertsteuerlichen Grundsätzen insbesondere den Prinzipien der Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit stehen.
(Extract)
Textprobe:
Kapitel A, Innergemeinschaftliche Lieferung:
I, Historische Entwicklung des Konstrukts der innergemeinschaftlichen Lieferung:
1. Binnenmarktkonzept unter der Berücksichtigung der Grundfreiheiten und Wettbewerbsneutralität als europarechtliche Basis:
Um einen Überblick über die Entwicklung des Begriffs der innergemeinschaftlichen Lieferung zu geben, ist auf die Anfänge der Europäischen Union zurück zu gehen, da bereits mit Abschluss des Vertrags der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1957 die Basis für dieses umsatzsteuerrechtliche Konstrukt gelegt wurde. Gemäß Art. 2 EWGV soll durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft gefördert werden. Geprägt ist der Begriff des Gemeinsamen Marktes durch die Verwirklichung dreier aufeinander aufbauender Momente. Erstens die Errichtung einer Zollunion, die nach außen eine ökonomische Einheit bildet und nach innen das Verbot von Zöllen und Abgaben innerhalb der Gemeinschaft festlegt; zweitens die Beseitigung aller Hemmnisse im innergemeinschaftlichen Handel mit dem Ziel der Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Binnenmarkt und drittens die Errichtung eines wettbewerbsneutralen Systems . Das Ziel des Gemeinsamen Marktes führt somit zum Zusammenwachsen Europas und verknüpft, um dies vorwegzunehmen, die Grundfreiheiten und die Wettbewerbsvorschriften. Auch in steuerlicher Hinsicht sind diese Ziele zu gewährleisten, sodass Steuergrenzen innerhalb der Gemeinschaft zu vermeiden sind und steuerliche Wettbewerbsneutralität hergestellt werden soll. Diskriminierungsverbote (Art. 95 bis 98 EWGV) und Steuerharmonisierung (Art. 99 EWGV) sind die sich gegenseitig ergänzenden Instrumentarien zur Durchsetzung der Idee eines Gemeinsamen Marktes im Bereich der Steuern .
Nachdem der Ausbau des Gemeinsamen Marktes Anfang der 1980er-Jahre ins Stocken geriet , wurde die Konzeption eines Europäischen Binnenmarktes auf Veranlassung der Europäischen Kommission vorangetrieben, welche am 14.6.1985 ein Weißbuch über die Vollendung des Binnenmarktes veröffentlichte. (...)