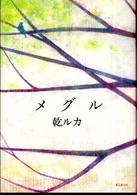Description
(Text)
Globale Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn es ihnen gelingt, ihre Geschäftsprozesse so zu koordinieren, dass eine effiziente Bearbeitung der als global angesehenen Märkte gelingt. Um Antworten darauf zu finden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit interkulturelle Kompetenz in der globalen Unternehmung einen Erfolgsbeitrag leistet, untersucht Daniel H. Scheible, was unter interkultureller Kompetenz zu verstehen ist und welchen Einfluss diese Kompetenz auf die Prozesse im globalen Unternehmen haben kann. Anschließend werden Maßnahmen und ihre Wirkungsweisen vorgestellt, mit denen das globale Unternehmen auf die interkulturelle Kompetenz im Unternehmen Einfluss nehmen kann. Neben der Effektivität interkultureller Trainingsmaßnahmen wird dabei auch auf deren Nachhaltigkeit eingegangen. Abschließend wird die Frage diskutiert, wie der Leistungsbeitrag interkultureller Kompetenz in global ausgerichteten Unternehmen zu bewerten ist.
(Extract)
Textprobe:
Kapitel 3.4, Interkulturelle Kommunikation:
Interkulturelle Kommunikation ist die Kommunikation zwischen Menschen, die verschiedenen Kulturen angehören, das heißt zwischen Menschen, die sich selbst einer anderen Kultur zugehörig fühlen, als der, der sie den Kommunikationspartner zurechnen. Nach Knapp und Knapp-Potthoff handelt es sich bei interkultureller Kommunikation um die interpersonale Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen, die sich mit Blick auf die ihren Mitgliedern jeweils gemeinsamen Wissensbestände und sprachlichen Formen symbolischen Handelns unterscheiden (Knapp/Knapp-Potthoff 1990: 66). Die Problematik bei der Kommunikation im interkulturellen Zusammenhang liegt also darin, dass der eine der Kommunikationspartner nicht mehr davon ausgehen kann, dass der andere über dasselbe Wissen verfügt, wie er selbst. Damit fehlt den Kommunikationspartnern die interpretative Folie für die Deutung des bisher Kommunizierten und die Orientierung für weiteres Handeln (Knapp/Knapp-Potthoff 1990: 66). In der interkulturellen Kommunikation können die Kommunikationspartner nicht auf einem über Jahrhunderte gewachsenen und immer schon fraglos vorhandenen Netzwerk kollektiver Selbstverständlichkeit aufbauen (Bolten 2000). Die Kultur des Kommunikationspartners ist daher eine fremde; der Gegenüber wird zu einem gewissen Grad als fremd empfunden.
Dieses Empfinden der Fremdheit steht im Gegensatz zu einem Gefühl der Vertrautheit in der eigenen Gruppe. Die Kultur der eigenen Gruppe bietet ihren Mitgliedern die Grundlage ihres Selbstverständnisses. Der Kontrast zwischen Fremdem und Eigenem betrifft so Waldenfels Erfahrungsgehalte und Erfahrungsbereiche. Wo Lebensbereiche und Lebenswelten im Persönlichen wie im Gesellschaftlichen ihre Vertrautheit verlieren (Waldenfels 1991: 58), beginnt das Fremde. Dieses stellt sich dem Individuum als eine unstrukturierte Situation dar, die eine Tendenz zur Wiedergewinnung von Vertrautheit, Orientierungs- und Handlungssicherheit (Thomas 1993: 259) aufkommen lässt.
Baecker stellt fest, dass es des Gegensatzes zwischen Vertrautheit und Fremdheit bedarf, um überhaupt erst auf ein Eigenes schließen zu können (vgl. Baecker 2000). Das bedeutet: ohne Fremdes keine eigene Kultur (Barloewen 1993: 299). Andererseits ist nach Baecker, das Fremde [...] Teil des Eigenen, das nichts anderes ist als die Abgrenzung vom Fremden, die Suche nach dem Kontrast (Baecker 2000: 16). Ebenso sieht das Brenner. Auch für ihn ist das Fremde immer Teil des Eigenen eben jenes Konstrukt, durch das das Fremde als Interpretament entsteht und das seine wesentlichen Kategorien aus der eigenen Kultur bezieht (Brenner 1999: 16).
So geht es, wie Gudykunst und Kim bemerken, in den meisten Konzepten um ein Gefühl der Vertrautheit in Abgrenzung zum Fremden (vgl. Gudykunst/Kim 2003). Wenn sich das Fremde aber anhand dieses Kriteriums konstituiert, so stellt Harman fest, ist in the dominant mode of social organization in westernsociety [ ] the stranger [...] not the exception but the rule. [ ] Strangeness is not longer a temporary condition to be overcome, but a way of life (Harman 1987: 44).
Ähnliche Beobachtungen stellt Georg Simmel bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts an. Für Simmel ist das Verhältnis von Kultur und Einzelmensch von sozialer, psychischer und wirtschaftlicher Entfremdung gekennzeichnet. In dieser Welt ist der Fremde derjenige, der zwar körperlich anwesend und an der Situation beteiligt, gleichzeitig aber außen vor ist, da er nicht Mitglied der Gruppe ist (vgl. Simmel 1968). In Simmels Augen verschafft ihm das einen höheren Grad an Freiheit, da er leichter zwischen den Gruppen wechseln kann und unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen leichter verstehen kann. Er ist der Freiere, praktisch und theoretisch, er übersieht die Verhältnisse vorurteilsloser, misst sie an allgemeineren, objektiveren Idealen (Simmel 1968: 510f.). Nach Geenen ist es dabei gut möglich, dass si