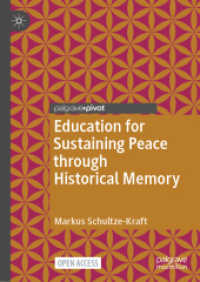Description
(Text)
Der Essay fragt nach der Bedeutung der Musik für den Philosophen Nietzsche und wirft einen Blick in seine Seele als Künstler: Wie geht diese mit der Welt in der Welt um? Wie findet sie Ausdruck in seinen Werken?Im Zentrum steht der künstlerische Philosoph Nietzsche: über dessen Verhältnis zur Musik wird ein neuer Blick auf sein Werk eröffnet. Dabei erweisen sich diese Werke als verzweifelte Versuche einer Selbstüberwindung, die seine, ihm bewussten wie unbewussten Seelengeheimnisse verarbeiten.Nietzsche hatte nicht bloß ein philosophisches Interesse an der Kunst, sondern erlebte ihre Wirklichkeit in ihrer ganzen, teilweise verzehrenden und hohe wie tiefe Stimmungen verleihenden Dramatik. Er war eine leidende, verwundbare und an große Ideale sich klammernde Künstlerseele. Musik war ihr Lebenselement. Seine Selbsterkenntnis verlief durch ein Sich-Wiedererkennen in der Musik. Er litt am Schicksal der Musik wie an einer offenen Wunde. Sein Geist kämpfte oft gegen die Seele, aber selbst seine Schöpfung des freien Geistes musste das Verbluten des Herzens in Kauf nehmen.
(Table of content)
Einleitung (8): a. Inwiefern wir noch fromme Hegelianer sind. (8) b. Warum ein Buch über Nietzsches Künstlerseele? (10) c. Gliederung (13); Teil 1: Die Künstlerseele: 1. Das Leiden am Ganzen und im Ganzen (18); 2. Musik (24): a. Die Liebe zur Musik (24) b. Tristan und Isolde als Ausdruck seiner Seele (26) c. Die Wirkung der Musik und der immer bleibende Wagnerianer? (29); 3. Verwundbarkeit (33): a. Die verwundbare und zärtliche Seele (33) b. Verwundbarkeit und Kunst (36) c. Melancholische Sehnsucht nach der Farbenpracht der Metaphysik in der freigeistigen Periode (38); 4. Religiöse Instinkte (41): a. Nietzsches Kampf gegen die religiösen Instinkte (41) b. Gethsemane und Golgatha als Symbole einer Gott suchenden Seele (44) c. Die Seele im Horizont der Ewigkeit (49); 5. Der kommende Gedanke (52): a. Woher kommt der Gedanke? (52) b. Erdichtungen (56); Teil 2: Die Künstlerseele in der Welt: Einleitende Worte (62); 6. Die junge idealistische Liebe (63): a. Zur Schrift Schopenhauer alsErzieher (63) b. Mut zum Selbstsein (65) c. Philosophischer Idealismus versus Wissenschaft (70) d. Das Ich und die Welt: Die Konstitutionsgefahren des Denkers (72) e. Die Macht der Vorbilder (75) f. Schmerzliche Begleitgedanken im Horizont des Nihilismus (79); 7. Einsamkeit und Überwindung (81): a. Der Ruf Zarathustras und die fehlende Antwort (81) b. Einsamkeit (84) c. Die ausgesuchten Seelen und das melancholische Glück (87); 8. Leiden und Sternenmoral (94); Literaturverzeichnis (101); Personenregister (104)
(Author portrait)
Henrik Holm, geb. 1980 in Oslo, Philosoph, Theologe und Autor, Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Rostock. Er wurde an der TU-Dresden (2010) zum Dr. phil. (Philosophie) promoviert. Zuvor absolvierte er das Studium der Theologie und der Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Musik (Klavier, Schlagzeug) an der Universität der Künste Berlin. Veröffentlichungen zu Augustinus, Kant, Nietzsche, Heidegger und Pieper; Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Ästhetik, Philosophie der Musik, Religionsphilosophie und Metaphysik.