- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Social Sciences, Jurisprudence & Economy
- > Politics, Society, Work
- > public administration
Description
(Text)
Was passiert bei einem sechstägigen Stromausfall in der Millionenstadt Berlin? Welche Behörden und Organisationen sind für die Bewältigung eines derartig katastrophalen Ereignisses zuständig? Wie funktioniert die Zusammenarbeit der Akteure. Welche Probleme müssen sie bewältigen?Wissenschaftler der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin haben sich im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts "TankNotStrom" mit diesen Fragen beschäftigt. Die Studie skizziert die verheerenden Auswirkungen eines anhaltenden Stromausfalles in Berlin. Sie geht jedoch über das Szenario hinaus und nimmt die zuständigen staatlichen und halb-staatlichen Akteure in den Blick. Besonderes Augenmerk gilt den Kooperationsstrukturen sowie den zwangsläufigen Veränderungen des Managements beim Übergang von der Krise zur Katastrophe. An den Problemen ansetzend, die in Berlin - aber auch in anderen Städten -bei langanhaltendem Stromausfall auftreten würden, gelangtdie Studie zu dem Ergebnis, dass die Bewältigung eines solchen Szenarios Änderungen beim Krisen- und Katastrophenmanagement verlangt. Hierbei steht vor allem eine Erkenntnis im Zentrum: Die Bevölkerung muss anders als bisher als aktiver Partner in das Krisen- und Katastrophenmanagement einbezogen werden. Dies gilt nicht nur für Berlin.
(Table of content)
1 Vorwort2 Das Szenario länger anhaltender Stromausfall in Berlin alsAusgangspunkt2.1 Infrastruktursektoren2.2 Resümee3 Vom Krisen- zum Katastrophenmanagement4 Rechtliche Grundlagen des Katastrophenschutzes4.1 Bundesgesetzgebung4.2 Ländergesetzgebung5 Die Berliner Akteure des Krisen- und Katastrophenmanagements5.1 Die Berliner Verwaltung5.2 Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport5.3 Die Berliner Bezirke5.4 Die Berliner Feuerwehr5.5 Die Berliner Polizei5.6 Die Hilfsorganisationen6 Weitere Akteure des Krisen- und Katastrophenmanagements6.1 Das Technische Hilfswerk6.2 Die Bundespolizei6.3 Die Bundeswehr6.4 Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe6.5 Die Unterstützung durch andere Länder7 Die Organisationsstrukturen für die Zusammenarbeit der Akteure7.1 Die Zusammenarbeit in der Gemeinsamen Einsatzleitung7.2 Arbeit in Krisenstäben7.3 Die Zentrale Einsatzleitung7.4 Zusammenfassung8 Prozess des (staatlichen) Krisen- und Katastrophenmanagements in Berlin8.1 Prozessbeschreibung8.2 Beginn (Zeitpunkt t0)8.3 Katastrophenalarm (Zeitpunkt t1)8.4 Wiederherstellung der Stromversorgung (Zeitpunkt t2)8.5 Aufhebung des Katastrophenalarms (Zeitpunkt t3)8.6 Prozess-Schaubild9 Entwicklungsperspektiven für das Krisen- und Katastrophenmanagement9.1 Stromausfall: eine stresstheoretische Betrachtung9.2 Vulnerabilitätstopographie in Berlin9.3 Erhebung der Ressourcen der Bevölkerung vor der Katastrophe9.4 Information der und Kommunikation mit der Bevölkerung9.5 Einbindung der Bevölkerung in das Krisen- und Katastrophenmanagement9.6 Einbeziehung der Bevölkerung vor der Krise9.7 Die Kommunikation der Akteure9.8 Das neue System "TankNotStrom"10 Ableitung von Konsequenzen für das Krisen- und Katastrophenmanagement10.1 Konkrete Handlungsempfehlungen10.2 Weitergehende Empfehlungen10.3 ForschungsperspektivenI. ProjektdatenII. Literatur- und QuellenverzeichnisIII. Abbildungs- und TabellenverzeichnisIV. Abkürzungsverzeichnis

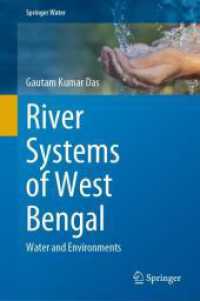



![すいぞくかんぴったりカード [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45911/4591115127.jpg)


