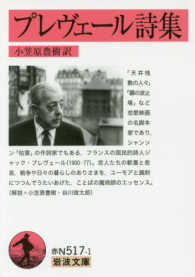Description
(Text)
Die Fallgeschichte ist in der Moderne eines der grundlegenden Narrative und Erkenntnisinstrumente nicht nur der wissenschaftlichen, sondern auch der populärkulturellen Beschreibung des Menschen, welche die Charakterisierung eines Individuums und seiner konkreten Lebensumstände mit grundsätzlichen anthropologischen Einsichten zu verbinden sucht. Großen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte des Falls hat eine um 1800 sich vollziehende fundamentale Umstellung der Epistemologie der Fallgeschichte, welche den Fall ausgehend von der Konstruktion eines Subjekts zu denken beginnt, das gerade aufgrund seiner Einzigartigkeit für andere Individuen repräsentativ sein soll. Die Untersuchung geht dieser Verschiebung nach, indem sie anhand von Johann Wolfgang von Goethes "Leiden des jungen Werthers", Friedrich Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre", Karl Philipp Moritz' "Aus K...s Papieren" und E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" vier zentrale Formationen des modernen Falldenkens analysiert und indiesen Analysen insbesondere solchen Interaktionen zwischen literarischen und psychologischen Beschreibungsmustern nachspürt, welche bis heute das Verständnis und die Regierung des Menschen prägen.
(Table of content)
1.Einleitung72.Das Paradigma Werther312.1Dichtung und Wahrheit312.2Schreiben als Lebens-Form40Poetik der Leerstelle: Subjektivität und skripturale Performativität44Werther als Lebens-Form57Der empfindsame Körper632.3Die Leiden des jungen Werther als literarische Fallgeschichte78Fallbeschreibungen I: Werther79Fallbeschreibungen II: Werthers Geschichten87Fallbeschreibungen III: Werthers Herausgeber96Von den Paradigmen im Werther zum Werther als Paradigma105Fallbeschreibungen IV: Werthers Epigonen1063.Rahmungen der Anthropologie: Schiller und der Fall Wolf1353.1Psychologie des Verbrechens und Ästhetik der Psychologie1403.2Schillers Poetologie des Falls1493.3Der Fall des Subjekts159Abel vs. Schiller: Von der kasuistischen Providenz zum autonomen Fall159Die narrative Disziplinierung des verbrecherischen Subjekts1724.Dokumentationen der Psychologie: Moritz und der Fall K...1914.1Paradoxien der Selbstbeobachtung1914.2Pathologien der Fremdbeobachtung1984.3Zur unendlichen Supplementierungdes Falls K2075.Pathologien der Reflexion: Hoffmann und der Fall Nathanael2205.1Die Imagination des psychologischen Subjekts2265.2Die Psychologisierung der Imagination2345.3Eine transzendentale Ästhetik der Fallgeschichte242Einen Fall erzählen: Nathanael als Dichter242Einen Fall beobachten: Die Krise der Perspektiven und die Perspektive der Krisen248Einen Fall erfinden: Die Urszene2566.Ausblick260Literaturverzeichnis266
(Author portrait)
Krause, Marcus Marcus Krause arbeitet als Literaturwissenschaftler an der Universität zu Köln. Neben Texten über Autoren wie Gottfried Benn, E. T. A. Hoffmann, Sigmund Freud, Robert Musil oder Thomas Pynchon hat er u. a. Bücher zur Fernsehserie 'The Wire', über das Verhältnis von Medien und Verschwörungstheorien, zur Kulturgeschichte des Menschenversuchs und über Normalisierungsprozeduren veröffentlicht.