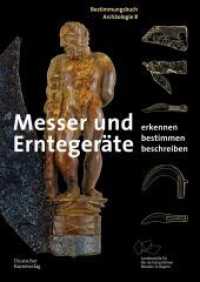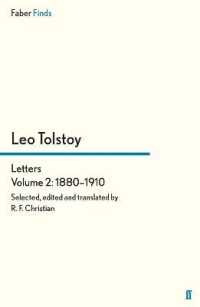- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > History
- > middle ages
Description
(Short description)
Mit seiner luziden Studie zu Form und Sinn des Reliquienschatzes der Reichsklosterkirche Centula führt Friedrich Möbius den Leser in die weit zurückliegende Welt zur Zeit Karls des Großen, die uns heute vor allem fremd und unverständlich, zuweilen aber auch geheimnisvoll und manchmal direkt grotesk anmutet. Und tatsächlich sind mehr als 1000 Jahre vergangen, seit der Abt Angilbert, dessen Person im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht, dort tätig war. Eine subtile Untersuchung der ihn leitenden Religiosität, die in den Quellen noch heute detailliert erschlossen werden kann, bedarf äußerster Sorgfalt bei der Interpretation der Befunde und verlangt eine vorbildliche gedankliche Strenge in der Ableitung der Folgerungen. Friedrich Möbius meistert diese schwierige Aufgabe überzeugend, wobei er den Leser schrittweise an das Weltverständnis der Klosterbewohner heranführt. Indem er die Rekonstruktion von deren leitenden Maximen Schicht für Schicht offenlegt, bereitet er den Boden für eine neue, über bisherige Würdigungen des Handelns von Angilbert hinausgehende Deutung. Weil er neben bekanntem Wissen auch lange verborgene und ignorierte Seiten der damaligen Ausprägungen der Religiosität zu Tiefendimensionen des menschlichen Bewusstseins, die unsere zeitgenössische Forschung erschlossen hat, in Beziehung setzt, gelingt ihm schließlich eine aufsehenerregende Neuinterpretation des lebensweltlichen Verständnisses der frühmittelalterlichen Religiosität.Diese Studie bilanziert eine jahrzehntelange gediegene Beschäftigung des Autors mit einer historisch lange zu wenig gewürdigten Persönlichkeit; dabei berührt sie zugleich zentrale Fragen unseres heutigen Denkens. Dieses Spannungsfeld in einer erregenden Weise ausgeschritten zu haben, ist das große Verdienst von Friedrich Möbius.
(Text)
Angilbert, der Schwiegersohn Karls des Großen und prominente Führungskraft des karolingischen Imperiums, stattete das ihm zur Neuordnung übertragene Reichskloster Centula - heute Saint-Riquier, gelegen im Nordwesten Frankreichs - mit Kirchengebäuden aus, die zu herausragenden Schöpfungen frühmittelalterlicher Architektur zählten. Der in die längst verlorengegangenen Gotteshäuser integrierte Reliquienschatz und dessen liturgische Verehrung werden in diesem Buch interpretiert als eine sublime Form der Sakralisierung karlischer Herrschaft. Die damaligen theologischen Überzeugungen, aber auch die Aktivierung archaischer Glaubensvorstellungen ermöglichten dem Abt, dem auch der militärische Schutz der gefährdeten Grenzprovinz oblag, sein Kloster als irdisches Abbild der von Heiligen bewohnten und geschützten apokalyptischen Himmelsstadt zu konzipieren. Die Nachzeichnung und Deutung dieses Vorgangs versteht sich als ein besonderer Beitrag zum Karlsjubiläum 2014.Hinzu tritt, dass hierzu ein grundlegender Quellentext der frühmittelalterlichen Geistes-, Religions- und Architekturgeschichte, der bislang nur selten und dann an versteckten Stellen Berücksichtigung fand, erstmals in seiner Gesamtheit gewürdigt wird. Reliquien des Mittelalters gelten gemeinhin als Gegenstände einer stark von magisch-abergläubischen Denkweisen geprägten Volksreligiosität. Die vom Autor, einem ausgewiesenen Architekturhistoriker, vorgenommene Durchsicht der Centulaer Quellen erlaubt eine erweiterte, auch modernem Verständnis zugängliche Deutung dieser Reliquien: Sie waren neben ihrer religiösen Funktion zugleich auch Gegenstände der zeitgenössischen Gedächtniskultur. Der dauernde und geordnete Umgang der Klosterbewohner mit legendären und historischen Gestalten der Kirchengeschichte, der in den heute üblichen Praktiken der Führung durch Museen und Gedenkstätten ein strukturelles Pendant findet, aktivierte das Geschichtsbewusstsein und stärkte die mentalen Kräfte der Klosterbewohner. Der Autor schlägt mit dieser Deutung ein semiotisches, zeichentheoretisches Verständnis von Glaubens-, Erinnerungs- und Gedächtnissymbolen vor, das zu allen Zeiten in die Lebenspraxis der Menschen eingeht und damit auch, wie die hier vorgelegte luzide Studie erweist, in die Gestaltung von Architektur.