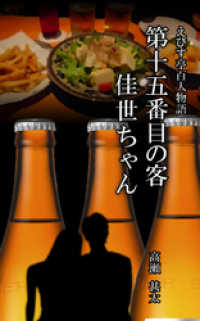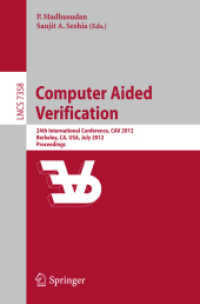- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Fiction
- > novels, tales and anthologies
Description
(Text)
Der sorbische Lyriker Benedikt Dyrlich wurde am 21. April 1950 alszweites von sechs Kindern eines Kleinbauern, Tischlers und Holzschnitzersin der Oberlausitz geboren. Die Mutter - eine Trachtenträgerin- starb, als der Junge 16 Jahre alt war. Das heimatlicheNeudörfel/Nowa Wjeska bei Kamenz hat die Berliner SchriftstellerinGisela Kraft nach einem Besuch am Ende der achtziger Jahre so beschrieben:"Dein Dörfel, liebe DDR. Grüne Wiesen, ziemlich fl ach. SaubereHäuser jüngerer Bauart. Nichts unter Denkmalschutz. Dafür vor demAnwesen der Dyrlichs ein Kapellchen, eine Schürzenlänge im Quadrat,mit schmucker bunter Madonna und frischen Schnittblumen. Der Bach,der durchs Dorf fl ießt, heißt Klosterwasser."Nach der Grundschule wurde Dyrlich ab Herbst 1964 Zögling desBischöfl ichen Vorseminars in Schöneiche bei Berlin. Von 1968 bis1970 studierte er in Erfurt katholische Theologie und legte die ersteHauptprüfung ab. Danach arbeitete er als Krankenpfl eger. 1973heiratete er die Bautzener sorbische Lehrerin und Journalistin MonikaRozowski. Anschließend war er dramaturgischer Mitarbeiter amDeutsch-Sorbischen Volkstheater, von 1975 bis 1980 studierte er inLeipzig Theaterwissenschaft. Danach war er am Bautzener Mehrspartenhaus als Dramaturg, später auch als Regisseur und Leiter des Kinder-und Jugendtheaters tätig. Dyrlichs erstes Gedicht, ein Marienlied,wurde 1967 von der sorbischen konfessionellen Wochenschriftgedruckt, sein erster Band, "Zelene hubki" (Grüne Küsse), erschien1975 im Domowina-Verlag Bautzen. 1977 war er in der richtungweisendenAnthologie junger Autoren "Kusk wuznaca" (Ein Stück Bekenntnis)vertreten. Inzwischen liegen etwa 15 Gedichtsammlungenvor, überwiegend in obersorbischer, vier in deutscher Sprache. Hinzukommen zahlreiche Übersetzungen, vor allem ins Polnische, Tschechische,Slowakische, Serbische, Ukrainische und Russische.Schon den Debütanten Benedikt Dyrlich trieb stets die eine Unruhe("Kleines lyrisches Bekenntnis", 1973): das Verlangen, die Welt zu erkennenund die Dinge bei ihrem Namen zu nennen. Diesen Namenwollte er in zweierlei sprachlicher Gestalt fi xieren: auf Sorbisch undauf Deutsch. Das literarische Erbe von Männern wie Augustinus, Novalis,Rilke oder Hermann Hesse regte ihn an, sich mit der sorbischenzugleich die deutsche Kultur zu erschließen. Ab 1968 gehörte derTheologiestudent zur Gruppe junger Lyriker beim Arbeitskreis sorbischerSchriftsteller im Schriftstellerverband der DDR, die der bekannteDichter Kito Lorenc betreute. Dyrlichs kurze, reimlose Gedichteaus jener Phase waren Ausdruck der Suche nach einem eigenenliterarischen Weltverständnis. Dabei empfand er die besondere Geschichte,Folklore und Mythologie, die sich mit dem Prädikat sorbischverband, anfangs durchaus als schwierig. In der einheitlichen sozialistischenSchule war dem traditionell erzogenen Sorben erläutertworden, was Traditionspfl ege sei oder die Aneignung von Traditionenausmacht: Ostereiermalen, Hochzeitsbräuche, alte Lieder, Hexenbrennenund Geschichten von Krabat, dem Zauberer ("Von der Suche nach derpoetischen Heimat",1980). Gegen eine offenkundig kontrollierte undmanipulierte Wirklichkeit musste sich das - noch ungefestigte - lyrischeIch daher energisch behaupten: Ich bleibe da, wo / mich dieseWelt am wütendsten zerreißt ("Entwurf eines Gedichts", 1975).Wie schon die frühen Gedichte bewiesen, verspürte Dyrlich seitjeher das Bedürfnis, den Alltag zu überschreiten. Den jähen Wendungenin seiner Biografi e verdankte er vielschichtige Erfahrungen ausden verschiedensten Bereichen. Die Legenden seiner Heimat wurdenzum Lößboden, auf dem poetische Metaphern mit universellerBedeutung gediehen. Die Widersprüche zwischen dem sorbisch-katholischen Bauerndorf und der preußisch-deutschen GroßstadtBerlin, zwischen der gewohnten Nähe zur Natur und der erlebtensozialen Entfremdung lieferten ergiebiges Material zur Refl exion.Dyr lich verarbeitete es nicht zu dem geforderten Realismus in denFormen