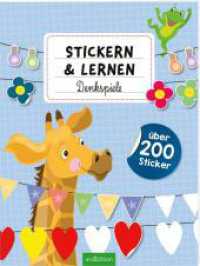Description
(Text)
Die Literatur der 1980er und 1990er Jahre hat die Geschichte als Sujet f r sich wiederentdeckt. Christoph Ransmayr tritt mit seinen drei Romanen Die Schrecken des Eises und der Finsternis , Die letzte Welt und Morbus Kitahara auf besondere Weise aus dem Kreis der deutschsprachigen Literaten heraus. Sowohl hinsichtlich des Arrangements inhaltlicher Elemente als auch in Bezug auf die Art und Weise der Darstellung stellen seine Texte bekannte Historie berraschend und neu dar. Daniela Henke arbeitet die innovativen Erz hlkompositionen dieser Romane in aufeinander aufbauenden Einzelanalysen heraus, bestimmt das mit ihnen transportierte Geschichtsbild und verortet es philosophisch. Als weiteren Schwerpunkt bietet die Studie eine breit angelegte Reflexion ber Ransmayrs Romanwerk im Kontext eines bergeordneten literarischen, historischen und philosophischen Diskurses. Dabei berzeugt Henke sowohl mit analytischer Tiefe als auch mit anschlussf higer Breite und leistet somit einen unerl sslichen Beitrag f r die aktuelle Forschungsdiskussion.
(Table of content)
Einleitung
I Die Postmoderne: Theoretische Grundlagen
I.1 Der postmoderne Diskurs: Entstehung und Hintergründe
I.1.1 Die Geschichte des Begriffs
I.1.2 'Postmoderne' als interdisziplinärer Begriff: Die Entwicklung der Debatte
I.1.3 Kritik und Problemlage
I.1.4 Über die Tauglichkeit des Begriffs 'Postmoderne': Eine Definition
I.1.4.1 Postmoderne als Diskurs
I.1.4.2 Postmoderne als Paradigmenwechsel des Denkens
I.1.4.3 Die Bedeutung der Geschichte
I.1.4.4 Postmoderne - eine Defintion
II.2 Geschichte neu denken - das postmoderne Geschichtsbild
I.2.1 Das moderne Geschichtsbild
I.2.2 Exkurs: Der Historismus
I.2.3 Das postmoderne Geschichtsdenken
I.2.4 Nachtrag: Das Posthistoire
II Das postmoderne Geschichtsdenken in Christoph Ransmayrs Romanwerk
II.1 Literaturtheoretische Einordnung
II.1.1 Ransmayrs Romanwerk als postmoderne Literatur
II.1.2 Die Genrefrage: Der Historische Roman
II.2 Die Einzelanalysen der Romane
II.2.1 Absage an die Fortschrittsutopie: Die letzte Welt
II.2.1.1 Rom als totalitäres Regime: Vernunft als Metaerzählung
II.2.1.2 Anspielungen auf den Nationalsozialismus
II.2.1.3 Tomi, die Peripherie und die an den Rand gedrängten Geschichten
II.2.1.4 Absage an den Fortschritt: Die Erzählweise
II.2.1.5 Zusammenfassung
II.2.2 Postmoderne Historiographie: Die Schrecken des Eises und die Finsternis
II.2.2.1 Fortschritt als primärer Wert
II.2.2.2 Die Linearität der Geschichte
II.2.2.3 Die Objektivität der Geschichtsschreibung
II.2.2.4 Die Gleichwertigkeit von fiktionalem und faktualem Erzählen
II.2.2.5 Das Spiel mit historiographischen Darstellungsformen
II.2.2.6 Helden und bedeutsame Ereignisse
II.2.2.7 Die Geschichten am Rande und das erlebende Subjekt
II.2.2.8 Zusammenfassung
II.2.3 Die Erfindung der Vergangenheit: Morbus Kitahara
II.2.3.1 Zur Wirkungsästhetik der kontrafaktischen Geschichtsdarstellung
II.2.3.2 Deutungsansätze
II.2.3.3 Die 'Wahrheit' des Einzelschicksals
II.2.3.4 Zusammenfassung
III Fazit: Ransmayrs Romanwerk als Interdiskurs
III.1 Die Romane: Drei literarische Neuperspektivierungen
III.2 Das Romanwerk: Die Genese des postmodernen Geschichtsdenkens
III.3 Der Diskurs: Postmoderne Geschichtsdarstellung
III.3.1 Der historische Diskurs: Die Wahrheitsfrage
III.3.2 Der soziologisch-philosophische Diskurs: Das Subjekt
III.3.3 Der literarische Diskurs: Das Einzelschicksal
III.3.4 Ransmayrs Romane als Interdiskurs: Resümee und Schlussbemerkung
Bibliographie