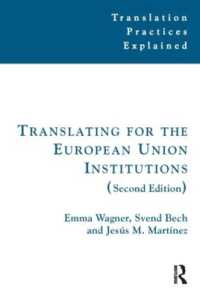Description
(Text)
Der Name Martin Walser ist seit seiner Friedenspreisrede 1998 für viele zur schlagwortartigen Bezeichnung für den Wunsch nach einem Schlussstrich unter das Gedächtnis an die nationalsozialistische Vergangenheit geworden. Dem steht andererseits ein idealisierendes Bild des miss-verstandenen Dichters vom Bodensee gegenüber. Beiden reduktionistischen Vorstellungen wird in dieser Analyse von zwei wirkungsmächtigen und für Walsers Umgang mit der NS-Vergangenheit zentralen Texten entgegengearbeitet, indem sie gleichzeitig in ihrem ästhetischen Eigenwert gewürdigt und in gesellschaftliche und politische Kontexte gestellt werden. Dies ist bislang, obwohl die Texte viele Reaktionen hervorgerufen haben, noch nicht in der wünschenswerten Genauigkeit und Ausgewogenheit unternommen worden. Die Studie argumentiert auf der Basis kulturwissenschaftlicher Theorien und einer ausführlichen literaturwissenschaftlichen Textanalyse, dass letztlich sowohl Walsers Rede als auch sein Roman, trotz der literarischen Komplexität der Werke, zu einem problematischen Gedächtnisdiskurs beitragen, der das Gedächtnis der Opfer innerhalb eines Diskurses nationaler Identität marginalisiert und sich auf eine beschönigende Geschichtskonstruktion der "Normalitat" des Alltags im Nationalsozialismus stutzt.
(Author portrait)
Kathrin Schödel hat an den Universitäten Erlangen- Nürnberg und Glasgow, Schottland, Neuere deutsche Literaturgeschichte, Englische Philologie und Germanistische Linguistik studiert. Zur Zeit arbeitet sie als Postdoktorandin an der Universität Erlangen- Nürnberg zum Thema "Revolution und Weiblichkeit".