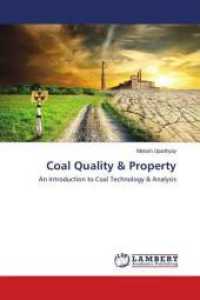Description
(Text)
Bei der Liberalisierung von Telekommunikation, Energieversorgung und Schieneninfrastruktur schuf der österreichische Gesetzgeber eine für Europa einzigartige, zweistufige Regulierungsinstanz: einerseits eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die gegenüber dem jeweiligen Ministerium weisungsgebunden ist, andererseits eine Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag. Der Autor diskutiert die daraus resultierenden verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Probleme und macht Vorschläge für die Neuorganisation der Regulierungsbehörden.
(Table of content)
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Erster Abschnitt: Einleitung
I. Gang der Untersuchung
II. Historische Entwicklung
A. Staatliches Engagement
B. Das Gemeinschaftsrecht als Motor der Marktöffnung
C. Privatisierung
Zweiter Abschnitt: Regulierung
I. Begriff(e)
A. Regulierung als Rechtsbegriff
B. Regulierung als rechtswissenschaftlicher Begriff?
II. Kategorisierung
A. Regulierung als Privatisierungsfolgenrecht
B. Regulierung als Liberalisierungsfolgenrecht
C. Regulierung als Summe der von den Regulierungsbehörden zu vollziehenden Regelungen
D. Definition
III. Regulierung im Rechtssinn
A. Das funktionale Element
B. Das finale Element der Regulierung
C. Das organisatorische Element
IV. Gegenstände der Regulierung
A. Marktteilnahmeregulierung
B. Marktverhaltensregulierung
V. Verfassungsrechtliche Grenzen
A. Grundrechte
B. VfSlg 17.819/2006
C. Verfassungskonformität der asymmetrischen Regulierung
D. Einzelne Regulierungsinstrumente
Dritter Abschnitt: Regulierungsbehörden
I. Terminologie
A. Gemeinschaftsrecht
B. Österreichisches Recht
C. Wesensmerkmale der Regulatoren
II. Von der Einstufigkeit zum zweigliedrigen Modell
A. Einstufiges Modell mit Kapitalgesellschaft
B. Einstufiges Modell mit Art 133 Z 4 Behörde
C. Der Weg zur Zweistufigkeit
III. Das Zweigliedrige Regulierungsbehördenmodell
A. Bestandsaufnahme
B. Zweistufigkeit
C. Aufgaben
D. Die Regulierungs-GmbHs
E. Die Regulierungs-Kommissionen
IV. Bedienstete
A. Ausgangslage
B. Institutionengarantie und spezifischer Funktionsvorbehalt
C. Sensibilität der Regulierungsverwaltung
D. Mitgliedschaft im VwGH
V. Finanzierung
A. Finanzierungsregelungen
B. Einordnung
C. Äquivalenzprinzip
D. Kostenüberwälzung
E. Vereinbarkeit mit Art 6 EMRK
Vierter Abschnitt: Demokratische Legitimation
I. Gegenstand der Untersuchung
A. Unabhängige Gewalt
B. Beleihung
II. Demokratische Legitimation als Rechtsbegriff
A. Begriffserklärungen
B. Das Demokratieprinzip
C. Strukturelle Elemente demokratischer Legitimation
III. Systematik demokratischer Legitimation
A. Klassische Modi der demokratischen Legitimation (Fremdsteuerung)
B. Selbststeuerung als Legitimationsmodus?
IV. Kein einheitliches Legitimationsniveau der Verwaltung
A. Die zwei Modelle der Verwaltungslegitimation
B. Abkehr von der funktionsbezogenen Legitimation in Art 20 B-VG?
V. Demokratische Legitimation der Regulatoren
A. Demokratische Legitimation der unabhängigen Regulierungs-Kommissionen
B. Demokratische Legitimation und Beleihung
Fünfter Abschnitt: Regulierungsverfahren
I. Anwendbares Verfahrensregime
A. Problemstellung
B. Streitbeilegungs- und -schlichtungsverfahren
C. Auskunftserteilung
D. Kontrolle von AGB
E. Wettbewerbsregulierung
F. Mangelnde Determinierung
II. Geschlossenheit des Rechtsquellensystems im B-VG
A. Enumerationssystem beim Rechtsschutz
B. (Absolute oder relative) Geschlossenheit oder Offenheit?
C. Ausgewählte Problemstellungen
III. Der vertragsersetzende Bescheid
A. Zweck und Rechtsnatur
B. Umfang der regulatorischen Befugnis
C. Vollstreckung
IV. Sonstige verfahrensrechtliche Problemstellungen
A. Das Sonderzwangsvollstreckungsrecht des EisbG
B. Herstellung des gesetzmäßigen Zustands
C. Auskunftspflichten / -rechte
Sechster Abschnitt: Zusammenfassung und Modelle
I. Zusammenfassung der Kritik
II. Regulatoren im Spannungsfeld der Anforderungen
III. Organisation
A. Einordnung
B. Einstufigkeit
C. Behörde oder privater Rechtsträger
D. Aufrechterhaltung der Sektorspezifität?
E. Weisungsfreiheit oder Unabhängigkeit?
F. Innere Organisation
IV. Rechtsschutz
V. Demokratische Legitimation
A. Ausgangslage
B. Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation
C. Personelle demokratische Legitimation
VI. Modelle
A. Das modifizierte Verwaltungsmodell
B. Das puristisch demokratische Modell
C. Das parlamentarische Modell
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis