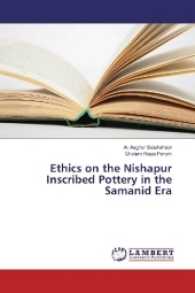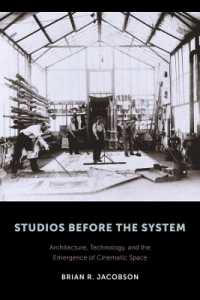Description
(Text)
Alle musikalische Praxis ist von Wertungen durchzogen. Das Publikum wertet Interpreten und Komponisten, auf oder ab; Interpreten lieben oder respektieren bestimmte Werke und ignorieren andere; Komponisten achten das Publikum oder missachten es. Wie aber solche Wertungen zustande kommen, weshalb sie sich durchsetzen oder nicht durchsetzen, und welche Maßstäbe ihnen zugrunde liegen, das verstehen wir viel zu wenig, und müssen es auch immer neu verstehen, denn etablierte Wertungen geraten außer Kurs und andere kommen in Geltung. Um Fragen dieser Art nachzugehen, begründete Harald Kaufmann 1968 die Studien zur Wertungsforschung. Wertungen, fand Kaufmann, sind kein undurchdringlich Letztes, Gefühle, über die sich nicht streiten ließe. Sie sind der Reflexion und Argumenten zugänglich wie auch bedürftig. Die verschiedenartigen Haltungen der Menschen stellen sie vor verschiedenartige Werte. Es mag keine höhere Warte - keinen, ästhetischenStandpunkt' - geben, von der aus die Gesamtheit der Werte in einem einzigen Wert - der, Schönheit' etwa zu betrachten wäre. Doch Wertfreiheit wäre auch für das Nachdenken über Musik kein gangbarer Weg. Wer verlangte, sich im Umgang mit Musik der Wertung zu enthalten, verstümmelte die Verständnisfähigkeit.
(Review)
Wie der Haupttitel erahnen lässt, geht der vorliegende Band Fragen zur musikalischen Interpretation vor dem Hintergrund von Theodor W. Adornos in dessen Ästhetischer Theorie formulierter Idee des "tour de force" an. [] ln seiner umfangreichen Anlage und theoretischen Ausrichtung bietet das Buch für interpretationsästhetisch und diskurstheoretisch Forschende im Bereich der Interpretation und Performance Studies eine lohnenswerte Lektüre. Ergiebigen Lesestoff kann der Band auch für interessierte Musikpraktiker darstellen, die grundlegende Fragen zu musikalischer Interpretation "abendländischer Kunstmusik" von ästhetisch kognitiver Seite her analytisch differenziert reflektieren und vertiefen wollen.
Dissonanze 06/15, S. 42 (Lena-Lisa Wüstendörfer)
(Text)
"Musical practice is permeated by valuation and judgment. Audiences judge performers and composers; performers dote on and honour certain works while disregarding others; composers respect audiences or despise them. How do such valuations come about? Why do some valuations prevail while others fade into oblivion? And which standards, if any, underlie them? Such matters must be explored ever anew..." This thinking drives the series Studien zur Wertungsforschung from the Institut für Musikästhetik, which delves deeper into the world of music than most would ever imagine. The latest volume published by Universal Edition is number 56 in the series. (Paperback, 496pp., German text)
(Author portrait)
Andreas Dorschel ist seit 2002 Professor für Ästhetik und Vorstand des Instituts für Wertungsforschung an der Kunstuniversität Graz (Österreich). Zuvor lehrte er Philosophie an Universitäten in Deutschland, England und der Schweiz. 1995 und 2006 war er Gastprofessor in den USA (Emory University, Stanford University).