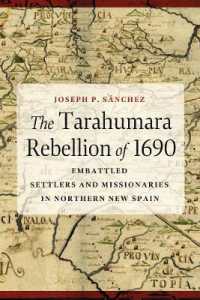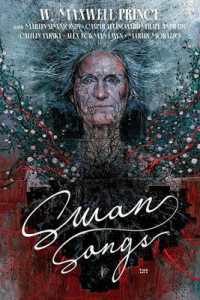Description
(Table of content)
Inhaltsverzeichnis-Contents.- Angiographie bei Schädel-Hirn-Verletzungen.- A. Einleitung.- B. Epidurale Hämatome.- C. Subdurale Hämatome.- D. Hygrome.- E. Intrazerebrale Hämatome.- F. Kombinierte ein- oder doppelseitige Hämatome.- G. Anderweitige Gefäßverletzungen.- H. Zirkulationsstörungen.- Das Röntgenbild der Großhirnvenen.- A. Technische Voraussetzungen.- B. Normale Röntgenanatomie.- C. Pathologische Befunde.- Die Diagnose der Infratentoriellen Tumoren durch die Vertebralisangiographie.- A. Das normale Phlebogramm der hinteren Schädelgrube.- B. Grundlegende Semiologie.- C. Arterielle Verlagerungen.- D. Verlagerung der Venen.- E. Gefäßneubildungen.- F. Gefäßlose Zonen.- G. Angiographische Zeichen des Hydrozephalus.- H. Topographische Diagnose.- Orbita-Phlebographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie und Röntgenanatomie des orbitalen Venensystems und seiner Zu- und Abflußbereiche.- C. Physiologie und Pathophysiologie des orbitalen Venensystems unter besonderer Berücksichtigung hämodynamischer Aspekte.- D. Methodik.- E. Komplikationen.- F. Das pathologische orbitale Phlebogramm.- G. Indikation, Reichweite und diagnostische Wertigkeit.- Die Jugularis-Venographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie der Vv. jugulares internae.- C. Untersuchungstechnik.- D. Indikationen zur Jugularisvenographie.- Angiographische Untersuchungen von Wirbelsäule, Spinalkanal und Rückenmark.- A. Arteriographie.- B. Phlebographie.- Computertomographie des Gehirns.- A. Einführung.- B. Grundlagen der Methode.- C. Das normale Computertomogramm.- D. Kontrastverstärkung im Computertomogramm.- E. Das Computertomogramm bei cerebralen Erkrankungen.- Literatur.- Namenverzeichnis-Author Index.delgrube.- B. Grundlegende Semiologie.- C. Arterielle Verlagerungen.- I. Die Verlagerung der Arteria basilaris.- II. Verlagerung des Chorioidalpunktes.- III. Die äußersten Punkte der Arteriae cerebri posteriores und der Arteriae cerebelli Superiores.- IV. Der Raum zwischen der A.prä- und post-communicans, der A. cerebri posterior und den präpontinen Abschnitten der A. cerebelli superior.- V. Verlagerung der Arteria vermis inferior.- VI. Verschiebung der A. cerebelli posterior inferior.- VII. Der Winkel der Arteria cerebelli superiores im Culmen gelegen.- VIII. Die Verlagerung des intrakranialen Abschnittes der A. vertebralis.- D. Verlagerung der Venen.- I. Verlagerung der vena cerebelli praecentralis.- II. Verlagerung des präpontinen Venensystems.- III. Verlagerung der Vena cerebelli inferior (v. vermis inf.).- IV. Abweichung des Sinus pretrosus superior oder der Vena Dandy.- V. Verlagerung der Vena vermis superior (v. cerebelli superior).- E. Gefäßneubildungen.- I. Glioblastome.- II. Astrozytom.- III. Meningiome.- IV. Metastasen.- V. Angioretikulome.- VI. Neurinome.- F. Gefäßlose Zonen.- G. Angiographische Zeichen des Hydrozephalus.- I. Der eigentliche Hydrozephalus.- II. Hydrozephalomyelie.- H. Topographische Diagnose.- I. Median gelegene Tumoren.- 1. Der Tumor des Hirnstamms.- 2. Tumoren des Klivus.- 3. Tumoren der 4. Ventrikels.- 4. Wurmtumoren.- II. Lateral gelegene Tumoren.- 1. Tumoren der Kleinhirnhemisphäre.- 2. Meningiome des Tentoriums.- 3. Tumoren des Kleinhirnbrückenwinkels.- Literatur.- Orbita-Phlebographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie und Röntgenanatomie des orbitalen Venensystems und seiner Zu- und Abflußbereiche.- I. V. ophthalmica superior.- II. V. ophthalmica inferior.- III. V. ophthalmica media.- IV. Kollateralvenen.- 1. Anteriore Kollateralvene.- 2. Mediale Kollateralvene.- 3. Laterale Kollateralvene.- 4. Posteriore Kollateralvene.- 5. V. lacrimalis.- V. Sinus cavernosus.- C. Physiologie und Pathophysiologie des orbitalen Venensystemsunter besonderer Berücksichtigung hämodynamischer Aspekte.- D. Methodik.- E. Komplikationen.- F. Das pathologische orbitale Phlebogramm.- I. Der unilaterale Exophthalmus.- 1. Der entzündliche Exophthalmus.- 2. Der blande, nicht pulsierende Exophthalmus.- 3. Der pulsierende Exophthalmus.- II. Die röntgenologische Interpretation des pathologischen orbitalen Phlebogramms.- 1. Teil- oder Nichtdarstellungen orbitaler Venen oder des Sinus cavernosus.- a) Entzündliche Prozesse.- b) Tumoren.- c) Strömungsänderungen.- 2. Verlagerungen.- 3. Kaliber- und Konturveränderungen.- 4. Pathologische Anfärbungen.- G. Indikation, Reichweite und diagnostische Wertigkeit.- Literatur.- Die Jugularis-Venographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie der Vv. jugulares internae.- I. Verlauf der Sinus durae matris.- C. Untersuchungstechnik.- I. Jugularisvenographie durch direkte perkutane Punktion der V.jugularis interna.- II. Retrograde Jugularisvenographie.- III. Retrograde Jugularisvenographie mittels der Seldin
Contents
Inhaltsverzeichnis—Contents.- Angiographie bei Schädel-Hirn-Verletzungen.- A. Einleitung.- B. Epidurale Hämatome.- C. Subdurale Hämatome.- D. Hygrome.- E. Intrazerebrale Hämatome.- F. Kombinierte ein- oder doppelseitige Hämatome.- G. Anderweitige Gefäßverletzungen.- H. Zirkulationsstörungen.- Das Röntgenbild der Großhirnvenen.- A. Technische Voraussetzungen.- B. Normale Röntgenanatomie.- C. Pathologische Befunde.- Die Diagnose der Infratentoriellen Tumoren durch die Vertebralisangiographie.- A. Das normale Phlebogramm der hinteren Schädelgrube.- B. Grundlegende Semiologie.- C. Arterielle Verlagerungen.- D. Verlagerung der Venen.- E. Gefäßneubildungen.- F. Gefäßlose Zonen.- G. Angiographische Zeichen des Hydrozephalus.- H. Topographische Diagnose.- Orbita-Phlebographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie und Röntgenanatomie des orbitalen Venensystems und seiner Zu- und Abflußbereiche.- C. Physiologie und Pathophysiologie des orbitalen Venensystems unter besonderer Berücksichtigung hämodynamischer Aspekte.- D. Methodik.- E. Komplikationen.- F. Das pathologische orbitale Phlebogramm.- G. Indikation, Reichweite und diagnostische Wertigkeit.- Die Jugularis-Venographie.- A. Einleitung.- B. Anatomie der Vv. jugulares internae.- C. Untersuchungstechnik.- D. Indikationen zur Jugularisvenographie.- Angiographische Untersuchungen von Wirbelsäule, Spinalkanal und Rückenmark.- A. Arteriographie.- B. Phlebographie.- Computertomographie des Gehirns.- A. Einführung.- B. Grundlagen der Methode.- C. Das normale Computertomogramm.- D. Kontrastverstärkung im Computertomogramm.- E. Das Computertomogramm bei cerebralen Erkrankungen.- Literatur.- Namenverzeichnis—Author Index.