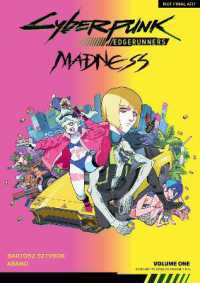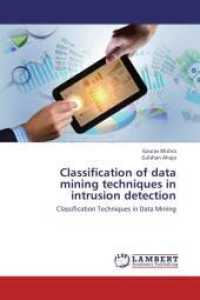Description
(Text)
Die Autorin untersucht in ihrer Arbeit, welche Bedeutung dem Willen des Patienten am Lebensende zukommt und an welche Grenzen der Wille stößt. Im Rahmen der passiven Sterbehilfe erfolgt eine Fokussierung auf die drei Willensformen - den aktuell geäußerten, den antizipierten und den mutmaßlichen Willen. Probleme im Umgang mit Patientenverfügungen sowie aktuelle Entwicklungen im Bundestag werden erörtert. Mithilfe eines Indizienkataloges entwickelt die Autorin fassbare Kriterien zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens für die Praxis. Anschließend werden Bedeutung und Grenzen des Patientenwillens in der aktiven Sterbehilfe, der Suizidbeihilfe und der indirekten Sterbehilfe aufgezeigt. Ziel der Untersuchung ist es, der verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmung des entscheidungsfähigen und -unfähigen Patienten weitestgehend Geltung zu verschaffen, um jedem Patienten ein selbstbestimmtes Sterben in Würde zu ermöglichen.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Zusammenhang von Medizin und Recht - Indikation und Wille - Patientenautonomie und Selbstbestimmung - Passive Sterbehilfe: Legitimation der Weiterbehandlung oder des Behandlungsabbruchs - Patientenverfügung: ein Instrument des antizipierten Willens - Subjektiv-mutmaßliche Willensermittlung unter Achtung der medizinischen Indikation - Aktive direkte Sterbehilfe und Rechtfertigungslösung - Indirekte aktive Sterbehilfe und Ausschluss des Tötungstatbestandes.
(Author portrait)
Die Autorin: Vanessa Schork, geboren 1980 in Heidelberg; ab 2000 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg; 2005 Erstes juristisches Staatsexamen; ab 2005 Doktorandin am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität Heidelberg; seit Ende 2006 Rechtsreferendarin am Landgericht Heidelberg.