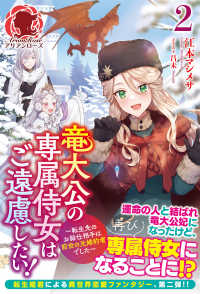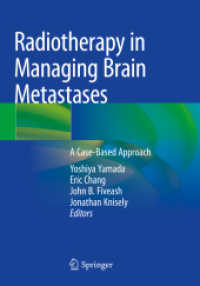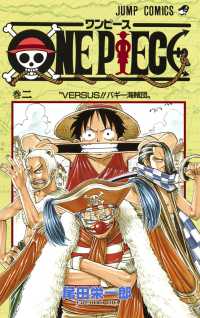- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > Linguistics
- > german linguistics
Description
(Text)
Der Vorgang des Erinnerns und die Rolle des Gedächtnisses sind historisch und systematisch Voraussetzung und Bedingung des autobiographischen Schreibens. Darüber hinaus waren und sind autobiographische Texte Seismographen für medieninduzierte Veränderungen. Insbesondere an den Transformationen der Schreibweise, die Benjamin in seiner Berliner Chronik und in Berliner Kindheit um Neunzehnhundert vornimmt, lassen sich Probleme der Medialität von Texten und Probleme kulturwissenschaftlich orientierter Gedächtnisforschung diskutieren. Das Gesamtwerk Benjamins zeigt eine stetige Auseinandersetzung mit Problemen der Medialisierung des Gedächtnisses: Die Genese und die Veränderungen hinsichtlich der kulturellen Bedeutung von Schrift und Buch, die Allegorie, die technische Entwicklung von Speicher- und Übertragungsmedien im 19. und 20. Jahrhundert (Film, Telephon, Photographie) lassen den Bruch mit einer Reihe von autobiographischen Darstellungstraditionen offenkundig werden.
(Table of content)
Aus dem Inhalt : Systemtheorie und Mediengeschichte - Formen und Funktion der Autobiographie um 1800 (Moritz, Goethe), Melancholie und Allegorie als autobiographische Verfahren - Intertextualität - Mnemopoetik des Autobiographischen (Proust, Freud) - Medientechnik und Semiotik des Erinnerung.
(Author portrait)
Der Autor: Markus Steinmayr, geboren 1968, studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Altgermanistik und Philosophie in Duisburg, Tübingen und Bochum. Prädikatsexamen 1998 (M.A.) mit einer Arbeit über Walter Benjamin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum im Rahmen eines vom Bildungsministerium NRW geförderten Forschungsprojekts zur Repräsentation der Macht. Arbeitet an einer Dissertation über Institution und Innerlichkeit in der Literatur und Autobiographie des 17. und 18. Jahrhunderts.