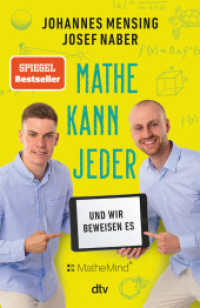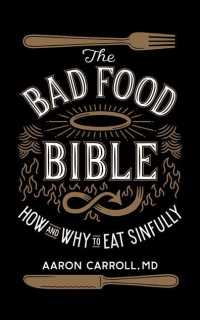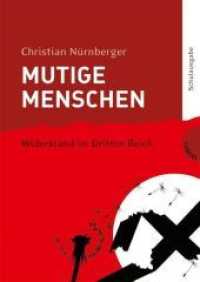- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Humanities, Arts & Music
- > History
- > antiquity
Description
(Text)
Die griechische Vasenmalerei überliefert seit ihrer Frühzeit vielfältige Darstellungen griechischer Götterfiguren. Doch erstmals um 500 v. Chr. bildeten die Vasenmaler reale Götterstatuen und Kultbilder ab. In der Arbeit wird der Beginn und die chronologische Entwicklung des künstlerischen Phänomens "Statuendarstellungen" herausgearbeitet. Eine Abhängigkeit der gemalten Götterstatuen von rundplastischen Götterbildern bestätigte sich nicht. Vielmehr verwendeten die attischen und unteritalischen Vasenmaler einerseits in bewußtem Rückgriff auf archaische Traditionen für ihre Statuen hocharchaische, in der Großplastik vorgeprägte Standbildtypen, andererseits aber auch ältere Standbildtypen des Strengen Stils oder annähernd zeitgleiche klassische rundplastische Typen und Bewegungsmotive. Die Erkenntnisse dieser Vorbild-Diskussion weisen die Statuendarstellungen als ein Phänomen des Archaismus aus, das sich problemlos in den chronologischen Ablauf der archaisierenden Kunst Griechenlands einordnen läßt. Die religionsgeschichtliche Betrachtung ließ ein gegenüber der archaischen Epoche deutlich differenziertes und distanziertes Verhältnis zwischen Kultbild und Gottheit deutlich werden. Die Statuendarstellungen der Vasenmalerei folgen hierin einer allgemeinen, sich ebenso in der Plastik und Kleinkunst widerspiegelnden Distanzierung von Göttersphäre und irdischem Bereich.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Materialzusammenstellung der attischen und unteritalischen Vasenbilder mit Darstellungen von Götterstatuen und Kultbildern - Kontextuelle Verknüpfung - Vorbilderfrage - Funktion und Begründbarkeit der Götterstatuen innerhalb der Bildkomposition - Religionsgeschichtliche Auswertung.
(Author portrait)
Der Autor: Werner Oenbrink wurde 1960 in Steinfeld (Oldbg.) geboren. Er studierte Klassische Archäologie, Ägyptologie und Alte Geschichte an der Universität Münster. Seine Dissertation wurde 1992 vom Deutschen Archäologischen Institut Berlin mit einem einjährigen Reisestipendium ausgezeichnet. Danach war er seit 1994 im Rahmen des Graduierten-Kollegs der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit dem Römisch-Germanischen Museum Köln mit der wissenschaftlichen Bearbeitung der «Kölner Jagdbecher» betraut und ist seit 1995 wissenschaftlicher Assistent am Archäologischen Institut der Universität zu Köln.