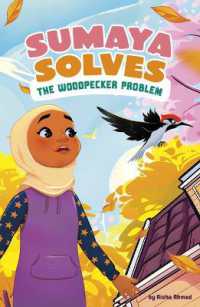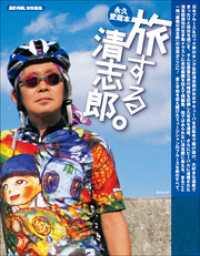- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Mathematics, Sciences & Technology
- > Chemistry
Full Description
Schlägt die Brücke zwischen Quantentheorie und Spektroskopie!
Spektroskopie ist das Arbeitspferd zur Struktur- und Eigenschaftsaufklärung von Molekülen und Werkstoffen. Um die verschiedenen spektroskopischen Methoden verstehen, kompetent anwenden und die Ergebnisse interpretieren zu können, ist grundlegendes Wissen der Quantenmechanik erforderlich: Konzepte wie stationäre Zustände, erlaubte und verbotene Übergänge, Elektronenspin und Elektron-Elektron-, Elektron-Photon- und Elektron-Phonon-Wechselwirkung sind die Grundlagen jeglicher spektroskopischen Methode.
Quantenmechanische Grundlagen der Molekülspektroskopie führt ein in die quantenmechanischen Grundlagen der Molekülspektroskopie, geschrieben vom Standpunkt eines erfahrenen Anwenders spektroskopischer Methoden. Das Lehrbuch vermittelt das notwendige Hintergrundwissen, um Spektroskopie zu verstehen: Energie-Eigenzustände, Übergänge zwischen diesen Zuständen, Auswahlregeln und Symmetrie. Zahlreiche Spektroskopiearten werden diskutiert, etwa Fluoreszenz-, Oberflächen-, Raman-, IR- und Spin-Spektroskopie.
* Perfekte Balance: ausreichend Physik und Mathematik, um Spektroskopie zu verstehen, ohne die Leserinnen und Leser mit unnötigem Formalismus zu überfrachten
* Relevantes Thema: spektroskopische Methoden werden in allen Bereichen der Chemie, Biophysik, Biologie und Materialwissenschaften angewandt
* Auf die Bedürfnisse Studierender zugeschnitten: der Autor ist ein erfahrener Hochschullehrer, der auch schwierige Aspekte verständlich vermittelt
* Hervorragende Didaktik: detaillierte Erklärungen und durchgerechnete Beispiele unterstützen das Verständnis; zahlreiche Aufgaben mit Lösungen im Anhang erleichtern das Selbststudium
Geschrieben für Studierende der Chemie, Biochemie, Materialwissenschaften und Physik, bietet Quantenmechanische Grundlagen der Molekülspektroskopie umfassendes Lernmaterial zum Verständnis der Molekülspektroskopie.
Contents
Vorwort xi
Einleitung xv
1 Übergang von der klassischen Physik zur Quantenmechanik 1
1.1 Beschreibung von Licht als elektromagnetische Welle 2
1.2 Strahlung des Schwarzen Körpers 3
1.3 Der photoelektrische Effekt 6
1.4 Absorptions- und Emissionsspektren von Wasserstoffatomen 8
1.5 Molekülspektroskopie 11
1.6 Zusammenfassung 13
Aufgaben 13
Literatur 15
2 Grundlagen der Quantenmechanik 17
2.1 Postulate der Quantenmechanik 18
2.2 Die potenzielle Energie und Potenzialfunktionen 22
2.3 Demonstration der quantenmechanischen Prinzipien für ein einfaches, eindimensionales Ein-Elektronen-Modellsystem: Das Teilchen im Kasten 24
2.4 Das Teilchen in einem zweidimensionalen Kasten, das ungebundene Teilchen und das Teilchen in einem Kasten mit endlichen Energiebarrieren 31
2.5 Reale Teilchen im Kasten: Konjugierte Polyene, Quantenpunkte und Quantenkaskadenlaser 35
Aufgaben 38
Literatur 40
3 Störung stationärer Zustände durch elektromagnetische Strahlung 41
3.1 Zeitabhangige Störungstheorie stationarer Zustande durch elektromagnetische Strahlung 41
3.2 Dipolerlaubte Absorptions- und Emissionsübergange und Auswahlregeln für das Teilchen im Kasten 45
3.3 Einstein-Koeffizienten für die Absorption und Emission von Licht 47
3.4 Laser 50
Aufgaben 52
Literatur 53
4 Der harmonische Oszillator, ein Modellsystem für die Schwingungen von zweiatomigen Molekülen 55
4.1 Klassische Beschreibung eines schwingenden zweiatomigen Modellsystems 55
4.2 Die Schrödinger-Gleichung, Energieeigenwerte und Wellenfunktionen für den harmonischen Oszillator 57
4.3 Übergangsmoment und Auswahlregeln für Absorption für den harmonischen Oszillator 63
4.4 Der anharmonische Oszillator 66
4.5 Schwingungsspektren von zweiatomigen Molekulen 69
4.6 Zusammenfassung 72
Aufgaben 73
Literatur 74
5 Infrarot und Raman-Schwingungsspektroskopie mehratomiger Moleküle 75
5.1 Schwingungsenergie mehratomiger Moleküle: Normalkoordinaten und normale Schwingungsmoden 75
5.2 Quantenmechanische Beschreibung molekularer Schwingungen in mehratomigen Molekülen 79
5.3 Infrarotabsorptionsspektroskopie 82
5.3.1 Symmetrieüberlegungen für dipolerlaubte Übergange 83
5.3.2 Bandenformen für Absorption und anomale Dispersion 84
5.4 Raman-Spektroskopie 88
5.4.1 Allgemeine Aspekte der Raman-Spektroskopie 88
5.4.2 Makroskopische Beschreibung der Polarisierbarkeit 89
5.4.3 Quantenmechanische Beschreibung der Polarisierbarkeit 90
5.5 Auswahlregeln für IR- und Raman-Spektroskopiemehratomiger Molekule 94
5.6 Beziehung zwischen Infrarot- und Raman-Spektren: Chloroform 96
5.7 Zusammenfassung: Molekulare Schwingungen inWissenschaft und Technologie 98
Aufgaben 98
Literatur 100
6 Rotation von Molekülen und Rotationsspektroskopie 101
6.1 Klassische Rotationsenergie von zwei- und mehratomigen Molekülen 102
6.2 Quantenmechanische Beschreibung des Drehimpulsoperators 105
6.3 Die Schrödinger-Gleichung für Rotation, Eigenfunktionen und Energieeigenwerte 107
6.4 Auswahlregeln für Rotationsübergange 112
6.5 Rotationsabsorptionsspektren (Mikrowellenspektren) 113
6.5.1 Starre zweiatomige und lineare Moleküle 113
6.5.2 Prolate und oblate symmetrische Kreisel 116
6.5.3 Asymmetrische Kreisel 118
6.6 Rotationsschwingungsübergange 119
Aufgaben 121
Literatur 123
7 Atomstruktur: Das Wasserstoffatom 125
7.1 Die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom 126
7.2 Lösungen der Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom 128
7.3 Dipolerlaubte Übergange für das Wasserstoffatom 134
7.4 Diskussion der Ergebnisse für das Wasserstoffatom 135
7.5 Elektronenspin 136
7.6 Raumliche Quantisierung des Drehimpulses 140
Aufgaben 140
Literatur 142
8 Kernspinresonanzspektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) 143
8.1 Allgemeine Bemerkungen 143
8.2 Rückblick auf Drehimpuls und Spindrehimpuls von Elektronen 144
8.3 Kernspin 146
8.4 Auswahlregeln, Übergangsenergien, Magnetisierung und Spinpopulationsanalyse 150
8.4.1 Auswahlregeln für den elektrischen Dipolübergang für ein Ein-Spin-Kern-System 150
8.4.2 Übergangsenergien 151
8.4.3 Magnetisierung 152
8.4.4 Analyse der Besetzung (Population) der Spinzustande 152
8.5 Chemische Verschiebung 153
8.6 Multispinsysteme 155
8.6.1 Nicht wechselwirkende Spins 155
8.6.2 Wechselwirkende Spins: Spin-Spin-Kopplung 157
8.6.3 Wechselwirkung mehrerer Spins 158
8.7 Puls-FT-NMR Spektroskopie 160
8.7.1 Allgemeine Bemerkungen 160
8.7.2 Beschreibung der NMR-Vorgange durch die ,,Nettomagnetisierung" 161
Aufgaben 162
Literatur 163
9 Atomstruktur: Mehr-Elektronen-Systeme 165
9.1 Der Zwei-Elektronen-Hamilton-Operator, die Abschirmung und die effektive Kernladung 165
9.2 Das Pauli-Prinzip 167
9.3 Das Aufbauprinzip 168
9.4 Periodische Eigenschaften von Elementen 169
9.5 Atomenergieniveaus 171
9.5.1 Gute und schlechte Quantenzahlen und Termsymbole 171
9.5.2 Auswahlregeln für atomare Übergange 174
9.6 Atomspektroskopie 175
9.7 Atomspektroskopie in der analytischen Chemie 176
Aufgaben 177
Literatur 178
10 Elektronische Energieniveaus und Spektroskopie mehratomiger Moleküle 179
10.1 Molekülorbitale und chemische Bindung im H2 +-Molekülion 180
10.2 Molekülorbitaltheorie für homonukleare zweiatomige Moleküle 184
10.3 Termsymbole und Auswahlregeln für homonukleare zweiatomige Moleküle 187
10.4 Elektronische Spektren von zweiatomgen Molekülen 189
10.4.1 Das vibronische Absorptionsspektrumvon Sauerstoff 189
10.4.2 Vibronische Übergange und das Franck-Condon-Prinzip 192
10.5 Qualitative Beschreibung elektronischer Spektren mehratomiger Moleküle 194
10.5.1 Auswahlregeln für elektronische Übergange 195
10.5.2 Gangige elektronische Chromophore 195
10.6 Fluoreszenzspektroskopie 199
10.6.1 Diagramm der Fluoreszenzenergieniveaus (Jablonski-Diagramm) 199
10.6.2 Interkombination (intersystem crossing) und Phosphoreszenz 200
10.6.3 Zwei-Photonen-Fluoreszenz (Two-Photon Fluorescence, TPF) 201
10.6.4 Zusammenfassung der Mechanismen für Raman-, Resonanz-Ramanund Fluoreszenzspektroskopie 201
10.7 Optische Aktivitat: elektronischer Zirkulardichroismus (ECD) und optische Rotation 203
10.7.1 Zirkular polarisiertes Licht und Chiralitat 203
10.7.2 Manifestation der optischen Aktivitat: optische Rotation, optische Rotationsdispersion und Zirkulardichroismus 204
10.7.3 Optische Aktivitat asymmetrischer Moleküle: das magnetische Übergangsmoment 206
10.7.4 Optische Aktivitat dissymmetrischer Moleküle: Übergangskopplung und Exzitonmodell 208
10.7.5 Optische Aktivitat in Molekülschwingungen 210
Aufgaben 211
Literatur 215
11 Gruppentheorie und Symmetrie 217
11.1 Symmetrieoperationen und Symmetriegruppen 218
11.2 Darstellung einer Gruppe 222
11.3 Symmetriedarstellungen molekularer Schwingungen 230
11.4 Symmetriebasierte Auswahlregeln für dipolzulassige Prozesse 234
11.5 Auswahlregeln für die Raman-Streuung 236
11.6 Charaktertafeln von gangigen Punktgruppen 237
Aufgaben 239
Literatur 240
Lösungen zu den Aufgaben 241
Anhang A Konstanten und Umrechnungsfaktoren 285
Anhang B Näherungsmethoden: Variations- und Störungstheorie 287
B.1 Allgemeine Bemerkungen 287
B.2 Variationsmethode 288
B.3 Zeitunabhangige Störungstheorie für nicht entartete Systeme 289
B.4 Detailliertes Beispiel für eine zeitunabhangige Störung: das Teilchen im Kasten mit geneigter Potenzialfunktion 290
B.5 Zeitabhangige Störung molekularer Systeme durch elektromagnetische Strahlung 295
Literatur 296
Anhang C Nicht lineare spektroskopische Methoden 297
C.1 Allgemeine Formulierung nicht linearer Effekte 297
C.2 Nicht koharente, nicht lineare Effekte: Hyper-Raman-Spektroskopie 298
C.3 Koharente nicht lineare Effekte 300
C.3.1 Frequenzverdopplung 300
C.3.2 Koharente Anti-Stokes-Raman-Streuung (CARS) 302
C.3.3 Stimulierte Raman-Streuung (SRS) und femtosekundenstimulierte Raman-Streuung (FSRS) 305
C.4 Nachbemerkung 306
Literatur 307
Anhang D Fourier-Transformationsmethodik 309
D.1 Einführung in die Fourier-Transformationsspektroskopie 309
D.2 Datendarstellung in verschiedenen Domanen 310
D.3 Fourier-Serie 310
D.4 Fourier-Transformation 313
D.5 Diskrete und schnelle Fourier-Transformationsalgorithmen 315
D.6 FT-Implementierung in EXCEL oder MATLAB 316
Literatur 317
Anhang E Beschreibung der Spinwellenfunktionen durch Pauli-Spinmatrizen 319
E.1 Die Formulierung der Spin-Eigenfunktionen 훼 und 훽 als Vektoren 320
E.2 Form der Pauli-Spinmatrizen 321
E.3 Eigenwerte der Spinmatrizen 323
Literatur 324
Stichwortverzeichnis 325