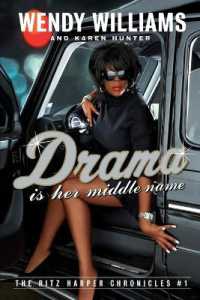Full Description
Der Klassiker der quantitativen Analyse liegt jetzt in der aktualisierten und ergänzten sechsten Auflage vor. Kompakt und umfassend werden die theoretischen Grundlagen und die praktische Anwendung der quantitativen Verfahren dargestellt, von den Standardmethoden Neutralisation, Fällungsanalyse, Komplexometrie und Redoxanalyse über elektrochemische und thermische bis hin zu spektroskopischen Verfahren.
Hinzugekommen sind in der neuen Auflage:
die Chromatographie, einschließlich der Ionenchromatographie
die optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)
Breiter behandelt werden verwandte Bereiche wie die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS). Das Buch führt damit die Studierenden kompetent an moderne apparative Methoden heran, die in der täglichen Laborpraxis an Bedeutung gewonnen haben.
Das Lehrbuch ist kompatibel mit den Inhalten der Bachelor-Studienpläne für Studierende mit Haupt- oder Nebenfach Chemie. Es ist ideal geeignet für die Vorbereitung auf die studienbegleitenden Prüfungen im chemischen Grundpraktikum und vergleichbaren Modulen.
Contents
Vorwort zur 6. Auflage v
Vorwort zur 5. Auflage vii
Vorwort zur 1. Auflage ix
Symbole xix
Mathematische Zeichen xxi
1 Einführung in die quantitative Analyse 1
1.1 Der analytische Prozess 1
1.2 Probennahme und Probenvorbereitung 2
1.3 Messung und Auswertung 4
1.4 Fehlerbetrachtung 5
1.4.1 Zufälliger und systematischer Fehler 5
1.4.2 Standardabweichung 6
1.4.3 Nachweis- und Erfassungsgrenze 8
1.5 Umgang mit Dezimalstellen 9
1.5.1 Signifikante Ziffern 9
1.5.2 Rechnen mit Dezimalzahlen 9
1.5.3 Anwendungsbeispiele 10
2 Chemisches Gleichgewicht 13
2.1 Homogene Systeme 13
2.1.1 Kinetische Betrachtung 13
2.1.2 Thermodynamische Betrachtung 15
2.2 Heterogene Systeme 18
2.2.1 Gleichgewicht Lösung I/lösung II 18
2.2.2 Gleichgewicht Gasphase/Lösung 19
2.2.3 Gleichgewicht Feststoff/Lösung 19
2.3 Schwache Elektrolyte 20
2.3.1 Einstufige Dissoziation 20
2.3.2 Mehrstufige Dissoziation 22
2.3.3 Experimentelle Bestimmung des Dissoziationsgrads 23
2.4 Starke Elektrolyte 25
2.4.1 Aktivitätsbegriff 25
2.4.2 Berechnung von Aktivitätskoeffizienten 26
2.4.3 Experimentelle Bestimmung von Aktivitätskoeffizienten 28
3 Gravimetrie 29
3.1 Fällungsform und Wägeform 29
3.2 Stöchiometrische Berechnungen 29
3.3 Lösen 32
3.3.1 Löslichkeitsprodukt 32
3.3.2 Löslichkeit 32
3.3.3 Fällungsgrad 34
3.4 Fällen 35
3.4.1 Keimbildung und Kristallwachstum 35
3.4.2 Kolloidbildung 36
3.4.3 Alterung 37
3.4.4 Mitfällung und Nachfällung 37
3.4.5 Komplexbildung 38
3.4.6 Fällung aus homogener Lösung 38
3.5 Anwendungsbeispiele 39
3.5.1 Chlorid-Fällung 39
3.5.2 Sulfat-Fällung 39
3.5.3 Hydroxid-Fällung 39
3.5.4 Phosphat-Fällung 40
3.5.5 Kalium-Bestimmung 40
3.5.6 Blei-Bestimmung 40
3.6 Organische Fällungsreagenzien 41
3.7 Praktische Hinweise 41
3.7.1 Filtrieren und Trocknen 41
3.7.2 Wägen 41
4 Maßanalyse (Titrimetrie) 45
4.1 Mengen-, Gehalts- und Konzentrationsangaben 45
4.1.1 Das Mol 45
4.1.2 Molare Masse 48
4.1.3 Gehalt und Konzentration 49
4.1.4 Mischungsaufgaben 53
4.2 Grundbegriffe der Maßanalyse 54
4.2.1 Volumenmessung 54
4.2.2 Titration 57
4.2.3 Indikation 58
4.2.4 Maßlösung 59
4.2.5 Probelösung 61
4.2.6 Titrationskurven 63
5 Säure-Base-Gleichgewichte 65
5.1 Säure-Base-Theorien 65
5.1.1 Arrhenius-Ostwald-Theorie 65
5.1.2 Brönsted-Theorie 67
5.1.3 Lewis-Theorie 68
5.1.4 Bjerrum-Theorie 69
5.2 Protolyse in wässriger Lösung 69
5.2.1 Eigendissoziation des Wassers 69
5.2.2 Säure-Base-Reaktion mit Wasser 70
5.3 Protolyse in nichtwässrigen Lösungsmitteln 72
5.4 Der pH-Wert 74
5.5 pH-Wert verschiedener Säure- und Basesysteme 76
5.5.1 Starke Protolyte 76
5.5.2 Schwache Protolyte 77
5.5.3 Mehrwertige Protolyte 78
5.5.4 Gemische starker Protolyte 79
5.5.5 Gemische schwacher Protolyte 79
5.5.6 Gemische aus starken und schwachen Protolyten 80
5.6 pH-Wert von Salzlösungen 81
6 Säure-Base-Titration 83
6.1 Titration starker Protolyte 83
6.2 Titration schwacher Protolyte 85
6.2.1 Titration einer schwachen Säure mit einer starken Base 85
6.2.2 Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure 87
6.2.3 Titration einer schwachen Säure mit einer schwachen Base 88
6.3 Säure-Base-Indikatoren 89
6.3.1 Zweifarbige Indikatoren 89
6.3.2 Einfarbige Indikatoren 91
6.3.3 Mischindikatoren 93
6.4 Titrationsfehler 93
6.4.1 Systematischer Fehler 93
6.4.2 Zufälliger Fehler 95
6.5 Anwendungsbeispiele 96
6.5.1 Titration von Carbonat (pKb =3,6) 96
6.5.2 Titration von Borsäure (pKs =9,3) 96
6.5.3 Titration von Ammonium (pKs = 9,25) 97
6.5.4 Kjeldahl-Aufschluss 97
6.5.5 Wasserhärte-Bestimmung 98
6.6 Titration in nichtwässrigen Lösungsmitteln 99
6.6.1 Wahl des Lösungsmittels 99
6.6.2 Titration von Basen 99
6.6.3 Titration von Säuren 100
6.7 Hägg-Diagramme 100
6.7.1 Mathematische Ableitung 100
6.7.2 Geometrische Konstruktion 102
6.7.3 Hägg-Diagramm einer schwachen Säure (pKs 7) 105
6.7.6 Hägg-Diagramm einer zweiwertigen Säure 106
6.7.7 Hägg-Diagramm von Salzen schwacher Protolyte 108
6.8 Titration mehrwertiger Protolyte 109
6.8.1 Titrationsdiagramm 109
6.8.2 Berechnung der stöchiometrischen Punkte 110
6.8.3 Verschiebung des Titrierexponenten bei hoher lonenstärke 112
6.9 Titration mehrerer Protolyte 113
6.10 Pufferlösungen 115
6.10.1 Pufferbereich 115
6.10.2 pH-Wert von Pufferlösungen 116
6.10.3 Pufferkapazität 117
6.10.4 Grafische Darstellung der Pufferfunktion 119
6.10.5 Anwendung von Pufferlösungen 120
7 Fällungsanalyse 121
7.1 Löslichkeit und Löslichkeitsprodukt 121
7.2 Schwerlösliche Säuren und Basen 122
7.3 Schwerlösliche Salze 124
7.3.1 pH-Abhängigkeit der Löslichkeit 124
7.3.2 Löslichkeitsdiagramm 125
7.3.3 Gekoppelte Salzauflösung und Salzfällung 128
7.4 Sulfidfällung 129
7.5 Hydroxidfällung 131
7.6 Fällung und Komplexbildung 133
7.6.1 Löslichkeit von Silberhalogeniden in Ammoniak 133
7.6.2 Trennung von Cu und Cd durch Fällung von CdS aus den Cyanokomplexen 134
7.7 Fällungstitration 134
7.7.1 Titrationskurve 134
7.7.2 Fraktionierte Fällung 136
7.7.3 Hägg-Diagramm zur Fällungstitration 138
7.8 Fällungsindikation 140
7.8.1 Titration ohne Indikator („Cyanid nach Liebig") 140
7.8.2 Indikation durch farbigen Niederschlag („Chlorid nach Mohr") 140
7.8.3 Indikation durch Anfärben des Fällungsprodukts (Adsorptionsindikatoren nach Fajans) 141
7.8.4 Indikation durch farbige Lösung („Silber nach Volhard") 142
7.8.5 Fluorid-Bestimmung 143
8 Komplexometrie 145
8.1 Komplexbildung 145
8.2 Analytische Anwendung 147
8.2.1 Mehrzähnige Liganden 147
8.2.2 Titrationskurve 150
8.2.3 Konditionalkonstante 152
8.3 Titrationsverfahren 154
8.4 Indikation 156
9 Redoxvorgänge 159
9.1 Oxidation und Reduktion 159
9.2 Elektrodenpotenzial 162
9.3 Allgemeine Form des Redoxpotenzials 166
9.4 Wasserstoff- und Sauerstoff-Elektrode 168
9.5 Normalpotenzial und Spannungsreihe 169
9.6 Redoxamphoterie 173
9.6.1 Luthersche Regel 173
9.6.2 Redox-Disproportionierung und -Komproportionierung 174
9.6.3 Gleichgewichtspotenzial 175
9.6.4 Anwendungsbeispiele 176
9.7 Gleichgewichtskonstante von Redoxreaktionen 177
9.8 Redoxtitration 179
9.8.1 Äquivalenzpotenzial 179
9.8.2 Titrationskurve 180
9.8.3 Berechnung der charakteristischen Punkte 181
9.9 Redoxindikatoren 183
9.9.1 Zweifarbige Indikatoren 183
9.9.2 Einfarbige Indikatoren 184
9.10 Kinetik von Redoxreaktionen 185
9.10.1 Reaktionshemmung 185
9.10.2 Induktion 186
10 Redoxtitration 189
10.1 Manganometrie 190
10.1.1 Grundgleichungen 190
10.1.2 Manganometrische Eisen-Bestimmung 191
10.1.3 Oxalat-, Peroxid- und Nitrit-Bestimmung 192
10.1.4 Mangan-Bestimmung nach Volhard-Wolff 193
10.2 Dichromatometrie 193
10.3 Bromatometrie 194
10.4 Iodometrie 195
10.4.1 Oxidimetrische Bestimmungen 197
10.4.2 Reduktometrische Bestimmungen 199
10.5 Cerimetrie 201
11 Trennungen 203
11.1 Aufschluss und Trennung 203
11.2 Stöchiometrische Berechnungen 204
11.3 Nasschemische Trennmethoden 206
11.3.1 Gruppentrennungen 206
11.3.2 Spezifische Fällung 207
11.3.3 Komplexbildung 208
11.3.4 Redoxreaktionen 209
11.4 Physikalisch-chemische Methoden 209
11.4.1 Destillation 209
11.4.2 Extraktion 210
11.4.3 Ionenaustausch 211
11.4.4 Elektrolyse 211
11.5 Aufschlüsse 212
11.5.1 Die Schmelze als Reaktionsmedium (Theorie von Bjerrum) 212
11.5.2 Sulfid-Aufschluss 213
11.5.3 Silicat-Aufschluss 214
11.5.4 Aufschluss von organischen Verbindungen 216
11.5.5 Moderne Aufschlussverfahren 218
11.6 Ionenaustauscher 218
11.6.1 Charakterisierung von Ionenaustauschern 221
11.7 Chromatografie 222
11.7.1 Verteilungsgleichgewicht 222
11.7.2 Flüssigkeits-Chromatografie (LC) 223
11.7.3 Ionen-Chromatografie 226
11.7.4 Gas-Chromatografie (GC) 226
11.7.5 Grundgleichungen der Chromatografie 229
12 Elektrochemische Methoden 231
12.1 Elektrolyse 231
12.1.1 Grundbegriffe 231
12.1.2 Zersetzungsspannung 234
12.1.3 Elektrogravimetrie 235
12.1.4 Coulometrie 238
12.1.5 Weitere Beispiele für coulometrische Redoxtitrationen 240
12.2 Konduktometrie 241
12.2.1 Theorie der Leitfähigkeit 241
12.2.2 Durchführung der Messung 246
12.2.3 Konduktometrische Titration 246
12.3 Potenziometrie 250
12.3.1 Grundlagen 250
12.3.2 Durchführung 251
12.3.3 Indikatorelektroden zur pH-Messung 252
12.3.4 Ionenselektive Elektroden 256
12.4 Polarisationsmethoden 258
12.4.1 Polarografie 259
12.4.2 Voltametrische Titration 262
12.4.3 Dead-Stop-Titration 265
13 Optische Methoden 269
13.1 Das elektromagnetische Spektrum 269
13.2 Brechungs- und Beugungsmethoden 271
13.2.1 Refraktometrie 271
13.2.2 Polarimetrie 272
13.3 Absorptionsmethoden 273
13.3.1 Lambert-Beersches Gesetz 274
13.3.2 Spektralphotometer 275
13.3.3 Kolorimetrie 275
13.3.4 Fotometrie 276
13.3.5 Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) 279
13.4 Emissionsspektrometrie 280
13.4.1 Übersicht 280
13.4.2 Flammenfotometrie 281
13.4.3 Icp-oes 282
A Anhang 285
A. 1 Physikalische Größen, Einheiten und Konstanten 285
A.. 1 SI-Basiseinheiten 285
A.1. 2 Abgeleitete SI-Einheiten 286
A.1. 3 Besondere Bezeichnungen für Vielfache von SI-Einheiten 286
A.1. 4 Einheiten, die nicht mehr verwendet werden sollen 287
A.1. 5 SI-Dezimalvorsätze 287
A.1. 6 Umrechnung alter und neuer Energieeinheiten 287
A.1. 7 Umrechnungsfaktoren für Druckeinheiten 288
A.1. 8 Physikalische Konstanten (auf 5 Dezimalen gerundet) 288
A. 2 Aktivitätskoeffizienten und analytische Konstanten 289
A.2. 1 Bestimmung von Aktivitätskoeffizienten nach Kielland 289
A.. 2 Von der effektiven Größe des hydratisierten Ions abhängiger k-Parameter 290
A.2. 3 Aktivitätskoeffizienten F I , Berechnet Nach Kielland für wässrige Lösungen bei 25◦c 291
A.2. 4 Löslichkeit anorganischer Verbindungen in Wasser bei 20◦c 292
A.2. 5 löslichkeitsprodukte KL 294
A.2. 6 Säurekonstanten pKs +pKb = 14 295
A.2. 7 Normalpotenziale 296
A.2. 8 Die chemischen Elemente 299
Literatur 301
Index 307