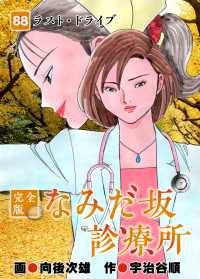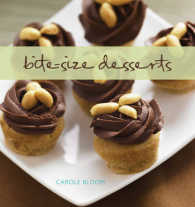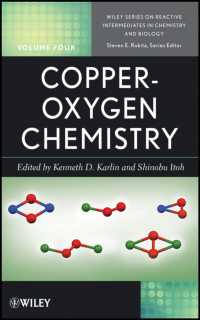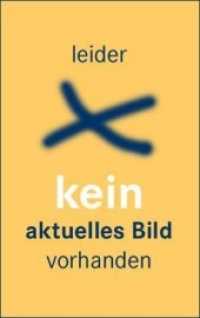Description
Die Studie untersucht Ikonografie, politische Semantik und liturgische Symbolik der Kubanischen Revolution und der argentinischen Guerilla, um der heilsgeschichtlichen Aufladung revolutionärer Bewegungen nachzuspüren. Das Zusammentreffen von christlicher Heilserwartung und jüdischer Erfahrung in Lateinamerikas Im Januar 1959 entfachte der Triumph der Kubanischen Revolution weltweit Begeisterung. Drei Jahre später sandte Ernesto "Che" Guevara eine Gruppe junger Männer von Havanna nach Südamerika, um die Revolution auf den Subkontinent zu übertragen. Im Norden Argentiniens sollten sie den Ejército Guerrillero del Pueblo, die Guerillaarmee des Volkes, aufbauen und einen bewaffneten Aufstand anführen. Doch die Operation scheiterte, die Mehrzahl der Mitglieder wurde verhaftet. Im Nachhinein wurde bekannt, dass die selbsterklärten Revolutionäre im Dschungel zwei ihrer Genossen zum Tode verurteilt und hingerichtet hatten. Beide Opfer waren jüdischer Herkunft. Ausgehend von diesen Ereignissen untersucht Lukas Böckmann Ikonografie, politische Semantik und liturgische Symbolik der Kubanischen Revolution und der argentinischen Guerilla, um der heilsgeschichtlichen Aufladung revolutionärer Bewegungen nachzuspüren. Er zeigt, wie sich die politisch-militärisch begründeten Handlungen als Ausdruck religiöser, insbesondere romanisch-katholischer Prägungen entschlüsseln lassen. Auf diese Weise werden die oftmals im Theoretischen verharrenden Debatten um Säkularisierung ins Empirische überführt. Es eröffnet sich ein über den behandelten Einzelfall weit hinausweisender Blick auf die Verflechtung von revolutionärem Denken und eschatologischen Erlösungshoffnungen. Lukas Böckmann ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Yfaat Weiss ist Professorin für Jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, steht dem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow vor und ist Professorin für Neuere, insbesondere jüdische Geschichte, an der Universität Leipzig.