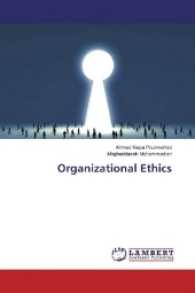Description
(Short description)
Die haftungsrechtliche Bewertung von Mitspielerverletzungen beim Sport stellt den Rechtsanwender vor erhebliche Herausforderungen. Einigkeit besteht dahingehend, dass nicht jede Mitspielerverletzung zur Haftung des Schädigers führen kann. Der Autor untersucht in diesem Zusammenhang, wie eine Haftungsbegrenzung beim Sport realisiert werden kann, und entwickelt auf Grundlage einer Verkehrspflichtkonzeption ein Modell zur Bewertung von Mitspielerverletzungen bei jeglichen Sportarten oder Spielen.
(Text)
Mitspielerverletzungen beim Sport sind ein omnipräsentes Alltagsphänomen. Gleichwohl sind bislang nicht alle wesentlichen Fragestellungen der zivilrechtlichen Sporthaftung durch Rechtsprechung und Literatur geklärt. Der Rechtsanwender trifft bei der Bewertung auf eine fast unüberschaubare Kasuistik. Von Rechtsklarheit kann teilweise nur schwerlich gesprochen werden. Einigkeit besteht lediglich, dass die Haftung für eine Mitspielerverletzung erst ab einem erheblichen Regelverstoß eintreten soll. Regelgerechtes Verhalten dagegen soll keinen Schadensersatzanspruch des Geschädigten auslösen. Die rechtliche Umsetzung hingegen ist umstritten. Der Autor untersucht in diesem Zusammenhang, wie eine Modifikation des Haftungsrechts bei der Sportausübung realisiert werden kann, und entwickelt auf Grundlage einer Verkehrspflichtkonzeption ein Bewertungsmodell, anhand dessen Mitspielerverletzungen bei jeglichen Sportarten oder Spielen einer abschließenden Lösung zugeführt werden können.
(Table of content)
A. EinleitungAusgangslage - Ziel der Untersuchung - Gang der Darstellung und methodisches VorgehenB. Übergeordnete Frage- und ProblemstellungenDas Interesse der Sportler an einer Haftungsmodifikation - Phänomenologie und Typologie des Sports und der Sportverletzung - Die Bedeutung des Regelwerkes und daraus resultierende Auswirkungen - Mögliche Anspruchsgrundlagen bei Mitspielerverletzungen - Die Unterscheidung zwischen Kampfsport und Parallelsport - Berücksichtigung von Spielen oder sportähnlichen Aktivitäten - ZwischenfazitC. Lösungsansätze bei regelgerecht verursachten MitspielerverletzungenRechtsfreier Raum und tatbestandsausschließendes Einverständnis - Tatbestand - Rechtswidrigkeit - Verschulden - Außertatbestandliche LösungsansätzeD. Eigener Lösungsansatz bei regelgerecht verursachten SchädigungenVerbliebene Optionen - Der Einfluss weiterer Determinanten - Auflösung der verbliebenen dogmatischen Herausforderungen - Die verbliebenen Lösungsansätze im Vergleich - Die dogmatischen Auswirkungen einer verkehrspflichtbasierten Lösung - Ergebnis: Das »Sporthaftungsprivileg« de lege lataE. Die Beurteilung regelwidrig verursachter MitspielerverletzungenDie Privilegierungswürdigkeit regelwidrigen Verhaltens - Die Umsetzung dieser MaximeF. Die Bestimmung der Verkehrspflichten bei der SportausübungDie »allgemeine« Verkehrspflichtformel als Ausgangspunkt - Die zentrale Bedeutung des Regelwerkes - Die Bestimmung weiterer Kriterien - Das Zusammenwirken der KriterienG. Praktische Problemfelder der Verkehrspflichtkonkretisierung beim SportBesondere Herausforderungen aus dem Bereich der Regelwerke - Das Schließen weiterer Bewertungslücken - Die Beurteilung einzelner typischer ProblemfelderH. Die Grenzziehung zwischen privilegierten und missbilligten MitspielerverletzungenPragmatik versus Dogmatik - Die möglichen Abgrenzungskriterien - Besondere Fallkonstellationen - Privilegierung trotz schwereren Regelverstoßes - FazitI. Die Privilegierung sportähnlicher Tätigkeiten und SpieleDas Dilemma der Rechtsprechung - Die Privilegierungswürdigkeit sportähnlicher Tätigkeiten - Die dogmatische Umsetzung dieser Maxime - FazitJ. Zusammenfassung der UntersuchungsergebnisseK. AusblickLiteratur- und Sachverzeichnis