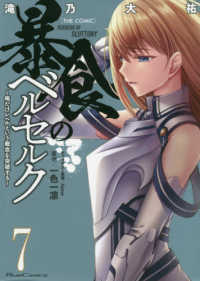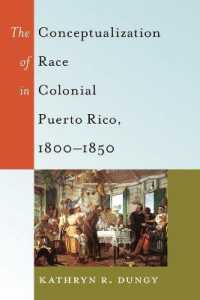Description
(Short description)
Das Verhältnis zwischen den Grundrechten und der Gewährleistung des freien Mandats (Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG) stellt Literatur und Rechtsprechung in mandatsbezogenen Zusammenhängen seit jeher vor Einordnungsprobleme. Für die bereichsdifferenzierte Zuordnung beider Normkomplexe wird ein auf dem verfassungsrechtlichen Repräsentationsverständnis basierender Lösungsvorschlag unterbreitet, der der Inhärenz von Person und Funktion in der Abgeordnetenrechtsstellung Rechnung trägt.
(Text)
Immer wieder berufen sich Abgeordnete bei der Frage nach der Rechtmäßigkeit von Maßnahmen mit Mandatsbezug auch auf Rechte, die ihnen nach verfassungsrechtlichem Duktus nur als natürlichen Personen zustehen - auf ihre (deutschen wie europäischen) Grundrechte. Während diese individualgerichtet sind, stellt das freie Mandat eine fremdnützig wahrzunehmende Rechtszuweisung des Abgeordneten dar. Als Ausdruck seiner Mittlerrolle zwischen Staat und Gesellschaft liegt das freie Mandat quer zur gängigen (beamtenrechtlichen) Differenzierung zwischen individueller und "amtlicher" Betroffenheit. Das Verhältnis beider Normkomplexe stellt Literatur und Rechtsprechung seit jeher vor Einordnungsprobleme. Die Arbeit unterbreitet einen Lösungsvorschlag für die bereichsdifferenzierte Zuordnung von Grundrechten und freiem Mandat. Dieser basiert auf dem verfassungsrechtlichen Repräsentationsverständnis und trägt der Inhärenz von Person und Funktion in der Abgeordnetenrechtsstellung Rechnung.
(Table of content)
EinleitungProblemstellung - Stand der Forschung und Themeneingrenzung - Gang der Untersuchung - Begriffsklärungen1. Funktionale Anwendbarkeit der Grundrechte und ihr Verhältnis zur Mandatswahrnehmung in der RechtsprechungProzessualer Hintergrund - Der innerparlamentarische Raum: Ausgewählte Fallgruppen - Der außerparlamentarische Raum: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Mittelpunktregelung und Offenlegung von Nebeneinkünften von Bundestagsabgeordneten - Ableitung der bisherigen verfassungsrechtsdogmatischen Ansätze2. Die Rolle des Bundestagsabgeordneten im staatlichen OrganisationsgefügeDie Unterscheidung von Staat und Gesellschaft - Eingliederung des Bundestagsabgeordneten in die institutionelle Staatlichkeit - Ergebnis: Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG als Hybrid zwischen Staat und Gesellschaft3. Das »Ob« der Grundrechtsberechtigung des Abgeordneten bei mandatsbezogenen Maßnahmen: Grundrechtsimpermeabler Abgeordnetenstatus?Rechts- und Pflichtenstellung des Abgeordneten - Begrifflicher Mythos vom »Abgeordnetenstatus«: Synonym für die Rechtsstellung des Abgeordneten oder eine Begrenzung grundrechtlicher Schutzbereiche?4. Das »Wie« der Grundrechtsberechtigung des Abgeordneten: Der Bundestagsabgeordnete als (partiell) andersartiger AmtsträgerBereichsdifferenzierte Grundrechtsgeltung anderer staatlicher Akteure: Korrelation von Weisungsgebundenheit und wehrfähiger Rechtsposition mit der jeweiligen Grundrechtsberechtigung des Amtsträgers - Die echte Eigenart der Abgeordnetenrechtsstellung: die Inhärenz der Person in der Funktion5. Bereichsdifferenzierte Zuordnung von freiem Mandat und GrundrechtenBestimmung der funktional nicht anwendbaren Grundrechte: Übernahme der Amtsträgerlösung, Art. 1 Abs. 3 GG - Konturierung des Verhältnisses von freiem Mandat und Grundrechten: Raum für gleichzeitigen Schutz für die personal anknüpfenden Inhalte des Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG - Lösungsvorschlag zur Zuordnung von Grundrechten und freiem Mandat unter Berücksichtigung der »Scharnierfunktion« des Bundestagsabgeordneten6. Einfluss der Europäischen MenschenrechtskonventionDie Quadratur des Kreises? - Konfusion von grundrechtlicher Freiheit und staatsorganisatorischer Befugnis auf Konventionsebene - ErgebnisZusammenfassung der Ergebnisse in ThesenLiteratur- und Sachverzeichnis