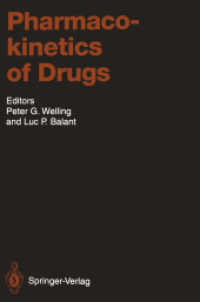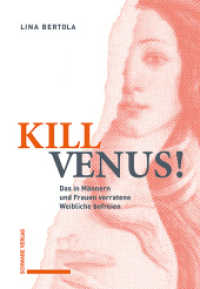- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Social Sciences, Jurisprudence & Economy
- > Jurisprudence & Law
- > trade & commercial lawindustrial law & social law
Description
(Short description)
Arbeitnehmer und Beamte werden bei berufsbedingten Unfällen mittels separater Absicherungssysteme geschützt, obwohl sie am Arbeitsplatz identischen Gefahren ausgesetzt sind. Doch wie weit reichen die Gemeinsamkeiten und wo liegen die Unterschiede bei der rechtlichen Anerkennung von Arbeits- und Dienstunfällen? Die Untersuchung geht dem nach und stellt zudem die Frage, ob sich eine unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern und Beamten auf diesem Gebiet sinnvoll begründen lässt.
(Text)
Kommt es bei einer berufsbedingten Tätigkeit zu einem Unfall, so kennt das deutsche Recht seit den 1880er Jahren zwei unterschiedliche Sicherungssysteme, die an den Status des Betroffenen anknüpfen: Während der Arbeitnehmer mittels der gesetzlichen Unfallversicherung vor den Folgekosten geschützt wird, unterliegt der Beamte der Dienstunfallfürsorge. Auf der Rechtsschutzebene entscheiden im ersten Fall die Sozialgerichte, wohingegen bei letzterem die Verwaltungsgerichte zuständig sind. Trotz nahezu identischer Gesetzestatbestände und einer vergleichbaren Gefährdungslage am Arbeitsplatz ist die Rechtsprechung der Sozial- und Verwaltungsgerichte nicht einheitlich. Die Arbeit nimmt eine grundlegende Gegenüberstellung der Rechtslage vor, um das Ausmaß der Divergenzen zu bestimmen. Darüber hinaus widmet sie sich der Frage, ob sich eine unterschiedliche Anerkennungspraxis rechtfertigen lässt, und plädiert im Ergebnis für eine weitgehende Maßstabsbildung anhand des Unfallversicherungsrechts.
(Table of content)
Einführung1. Die Auslegung des Arbeits- und DienstunfalltatbestandesA. Der Grundtatbestand des Arbeits- und Dienstunfalls: Grundlagen - Zurechnung einer Verrichtung zur versicherten Tätigkeit und zum Dienst - Unfallereignis - Ursächlicher Zusammenhang zwischen Tätigkeit und Unfallereignis - Ursächlicher Zusammenhang zwischen Unfallereignis und Schädigung - Ursächlicher Zusammenhang zwischen Primärschaden und Folgeschäden - Ergebnisse für den GrundtatbestandB. Der Tatbestand des Wegeunfalls: Grundlagen - Anfangs- und Endpunkt des Weges - Unmittelbarer Weg - Ergebnisse für den Wegeunfalltatbestand2. Bewertung der Divergenzen und kritische Überprüfung der vorgebrachten ErklärungsansätzeA. Ausgangsüberlegungen: Bewertung der Divergenzen - Keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG - Meinungsstand: Erklärungsbedürftigkeit der DivergenzenB. Wiedergabe und Bewertung der vorgebrachten Begründungen: Zirkelschlüssige Begründungsansätze - Dienstunfalltatbestand: »enger gefasst«? - Wegeunfall in 31 Abs. 2 BeamtVG: zurückhaltend auszulegen? - Finanzierung, Versicherungsprinzip und Entstehungsgeschichte als Ansatzpunkte?3. Leitlinien für eine Harmonisierung bei der Anerkennung von Arbeits- und DienstunfällenA. Ausgangsüberlegungen: Kontinuität der institutionellen Trennung - Die Rechtsprechung als AusgangspunktB. Thesen: Erste These: Anerkennung eines Arbeitsunfalls nach 8 SGB VII als Mindeststandard für das Dienstunfallrecht - Zweite These: Fortentwicklung des Dienstunfallrechts durch Adaption der arbeitsunfallrechtlichen Dogmatik - Dritte These: Extensiver Dienstunfallschutz nur in konkretisierten Konstellationen4. Resümee und AusblickLiteraturverzeichnis und Sachwortregister