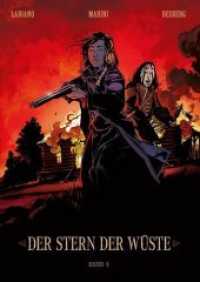Description
(Short description)
Die Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten mit Polizei und Staatsanwaltschaft ist seit jeher ein besonders brisantes Thema. Der Autor untersucht in seiner Arbeit grundlegend, wann Nachrichtendienste ihre Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden weitergeben dürfen oder gar weitergeben müssen. Das Thema ist seit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zum Antiterrordateigesetz vom 24. April 2013 von besonderer Aktualität. Ausgehend von den dort aufgestellten verfassungsrechtlichen Maßstäben untersucht der Autor alle bestehenden Übermittlungsvorschriften der Nachrichtendienste und unterbreitet konkrete Reformvorschläge.
(Text)
Die Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten mit Polizei und Staatsanwaltschaft ist seit jeher ein besonders brisantes Thema - die Ereignisse um den »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) und die aktuellen Enthüllungen in der »NSA-Affäre« haben dies zuletzt besonders deutlich gezeigt.
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, wann Nachrichtendienste ihre Erkenntnisse über (möglicherweise) begangene Straftaten an Strafverfolgungsbehörden weitergeben dürfen oder gar weitergeben müssen. Weil Nachrichtendienste weit im Vorfeld tätig werden dürfen und über besonders weitgehende Befugnisse verfügen, ist diese Frage rechtsstaatlich vor dem Hintergrund des Trennungsgebots besonders delikat. Besondere Aktualität hat dieses Thema durch das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zum Antiterrordateigesetz vom 24. April 2013 erhalten. Anhand des verfassungsrechtlichen Maßstabes im Urteil zum Antiterrordateigesetz untersucht Nikolaos Gazeas grundlegend alle relevanten Übermittlungsvorschriften der Nachrichtendienste. Daneben beleuchtet er die Frage, wann Strafverfolgungsbehörden bei Nachrichtendiensten Auskunft verlangen dürfen.
Ausgehend von den identifizierten verfassungsrechtlichen Defiziten und übrigen Schwächen im geltenden Recht entwickelt der Autor konkrete Reformvorschläge in der gerade erst begonnenen Reformdiskussion. Die Arbeit enthält daneben einen ausführlichen Überblick über das aktuelle Recht der Nachrichtendienste und die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Übermittlung personenbezogener Daten.
Ausgezeichnet mit dem CBH-Promotionspreis 2014 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
(Table of content)
n
3. Übermittlung auf Initiative der Nachrichtendienste (Spontanübermittlung)
Die Spontanübermittlungsvorschriften der Nachrichtendienste im BVerfSchG, BNDG, MADG, im G 10 und in den 16 Verfassungsschutzgesetzen der Länder - Übermittlungspflicht der Nachrichtendienste: 20 Abs. 1 BVerfSchG - Übermittlungsverbot nach 23 BVerfSchG - Übermittlungsbefugnis nach 19 Abs. 1 BVerfSchG - Verfassungsmäßigkeit der Übermittlungsvorschriften vor dem Hintergrund des Urteils des BVerfG zum Antiterrordateigesetz
4. Übermittlung auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden - 161 Abs. 1, 163 Abs. 1 Satz 2 StPO und die Verwendungsbeschränkung nach 161 Abs. 2 StPO
Auskunftsverlangen: Voraussetzungen und Grenzen - 161 Abs. 1 StPO keine ausreichende verfassungsrechtliche Rechtsgrundlage für eine Auskunft; Erfordernis einer gesonderten Übermittlungsbefugnis - Verwendungsregelung nach 161 Abs. 2 StPO und ihre Auswirkungen im nachrichtendienstlichen Kontext - Übermi
(Author portrait)
Nikolaos Gazeas studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Köln, Bonn, Heidelberg und Thessaloniki. Nach dem ersten Staatsexamen folgte ein Master-Studium (LL.M.) an der University of Auckland in Neuseeland. Seit 2009 arbeitet Nikolaos Gazeas als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für deutsches und internationales Strafrecht von Professor Dr. Claus Kreß LL.M. (Cambridge) an der Universität zu Köln. Im Jahr 2012 war er als Visiting Scholar an der University of California, Berkeley. Im selben Jahr trat er den Referendardienst in Köln an. Zugleich blieb Nikolaos Gazeas wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln, wo er auch heute noch arbeitet. Die Promotion erfolgte 2013. Seine Dissertation wurde mit dem CBH-Promotionspreis 2014 ausgezeichnet.