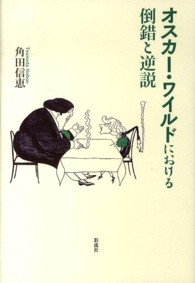- ホーム
- > 洋書
- > ドイツ書
- > Social Sciences, Jurisprudence & Economy
- > Jurisprudence & Law
- > trade & commercial lawindustrial law & social law
Description
(Text)
Warum soll Urheberrecht überhaupt sein? Diese Frage ist bislang wissenschaftlich vernachlässigt worden. Das hat zu Rechtfertigungsformeln geführt, deren Rationalität und urheberrechtliche Implikationen im Dunkeln geblieben sind. Was fehlte, war der Versuch, jene Frage in einer begrifflichen, systematischen und methodologischen Klarheit zu behandeln, die denkbare Antworten in rationale Argumente überführt.
Christian Stallberg möchte dieses Defizit beseitigen. Ziel ist es, die Vorstellungen über die Moralität des Urheberrechts auf die aufgeklärte Ebene heutiger rechtsphilosophischer Diskurse zu heben. So wird ein Programm verfolgt, das der Verfasser als Analytik des Urheberrechts als Gegenstand der Moral begreift.
Dabei entwickelt der Autor in erster Linie eine analytische Typologie denkbarer Begründungsmodelle des Urheberrechts. So wird die Basisdifferenz zwischen individualistischen und kollektivistischen Modellen herausgearbeitet, mit der sechs Argumentationstypen idealrekonstruiert und in ihren institutionellen sowie inhaltlichen Folgen für das Urheberrecht erörtert werden. Stärken und Schwächen dieser Modelle werden zudem präzise analysiert. So zeigt sich, dass individualistische als auch kollektivistische Modelle aus je verschiedenen Gründen nicht überzeugen.
In zweiter Linie skizziert der Verfasser einen argumentativen Weg, der jenseits des Konflikts zwischen individualistischen und kollektivistischen Modellen liegt. Dazu schlägt er eine sprachphilosophische Lesart des Urheberrechts vor. So wird ein Paradigmenwechsel eingeleitet, der das traditionell gegenstandsbezogene urheberrechtliche Denken zugunsten eines Denkens in kommunikativen Handlungen und ihren Regeln aufgibt.
(Table of content)
Inhaltsübersicht:
1 Einleitung: Legitimationsprobleme des Urheberrechts - Rechtliche Relevanz einer moralischen Rechtfertigung - Das Defizit des gegenwärtigen Forschungsstands - Ziele und Gang der Untersuchung -
2 Die moralische Begründung des Urheberrechts: Theoretische Grundlagen - Differenz der Begründungsmodelle - Zusammenfassung -
3 Begründungsmodelle des Urheberrechts: Individualistische Rechtfertigungsmodelle - Kollektivistische Rechtfertigungsmodelle - Eine universalistisch-transzendentale Rechtfertigung des Urheberrechts -
4 Schluss: Eine analytische Typologie der Begründungsmodelle - Die rationale Bewertung der Begründungsmodelle - Die Lösung eines universalistisch-transzendentalen Modells - Fazit - Literaturverzeichnis - Sach- und Personenregister
(Review)
arum' des Urheberrechts. Gerade in Zeiten größter Bedrängnis des Urheberrechts ist eine solche Grundlagenvergewisserung mehr als angebracht. [...] Vielmehr stellt Stallberg übergreifend drei Begründungsmodi des Urheberrechts auf, und zwar den individualistischen, kollektivistischen und universalistisch-transzendentalen. Ihm geht es hierbei darum, das moralische Nachsinnen über das Urheberrecht zu rationalisieren, indem er strukturierte Diskursbahnen anempfiehlt (S. 335). [...] Die vorliegende Arbeit leistet zu diesem aktuellen und global bedeutsamen Rechtsfertigungsdiskurs einen vorzüglichen Grundlagenbeitrag.«
Dr. Hannes Rösler, in: Juristenzeitung, 4/2007
»So muß Stallberg am Ende seiner Arbeit mit Wittgenstein konstatieren, daß 'am Grunde des begründeten Glaubens' stets 'der unbegründete Glaube' liegt und selbst eingestehen, daß die Arbeit 'ihren Sinn in erster Linie darin sieht, das moralische Nachdenken über das Urheberrecht zu rationalisieren, in dem sie es in vorstrukturierte Bahnen lenkt'. Dafür bietet das vorliegende Werk, das unter der Fülle urheberrechtlicher Arbeiten durch seinen unkonventionellen - weil in der traditionellen Selbstrekonstruktion des Urheberrechts ungewohnten 'externen' - Erklärungsansatz hervorsticht, einen zu vielfältigen Reflektionen anregenden Ausgangspunkt. Jedenfalls ist derjenige, dem es wirklich um das Urheberrecht und um den Schutz des kreativ tätigen Menschen geht, schlecht beraten, lediglich interessenpolitisch geleitet nach einer Verstärkung des Ausschließlichkeitsschutzes zu rufen. Vielmehr sollte er sich differenziert mit den Schutzgründen und deren jeweiliger rechtspolitischer Ableitung auseinandersetzen.«
Prof. Dr. Thomas Dreier, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2/2007